Wikipedia:Vermittlungsausschuss/Artikel Bibelkritik/Version von Mac ON
Vorwort: Dies nur ein unfertiger Entwurf. Folgende Teile sind fertig: Die ersten beiden Absätze zur Geschichte und beiden Abschnitte zur Rolle der Frauen im AT und NT.
Bibelkritik bezeichnet im allgemeinen Fall jede Form der kritischen Beschäftigung der Bibel.
Im wissenschaftlichen Sprachgebrauch wird der Begriff auch spezieller für die textkritische Untersuchung von Quellen und Textvarianten benutzt. Dies wird wird unter historisch-kritische Methode beschrieben, Ergebnisse daraus unter Altes Testament, Textkritik des Neuen Testaments, Textgeschichte des Neuen Testaments sowie in Artikeln zu einzelnen Büchern der Bibel.
Zur Übersetzung der Bibel siehe auch Bibelübersetzung und Geschichte der Bibelübersetzung, zu ihrer Auslegung siehe Biblische Exegese.
Geschichte: Bibelkritik in der Neuzeit
[Quelltext bearbeiten]
Die moderne Bibelkritik geht vor allem auf Renaissance und Aufklärung zurück. Das Aufkommen kritischer Wissenschaften, die sich nicht direkt der Religion verpflichtet fühlten, wie beispielsweise der vergleichenden Geschichte, führte zu Auseinandersetzungen mit klerikalen Autoritäten. Hobbes, Simon, und vor allem Spinoza veröffentlichen im 17. Jahrhundert bibelkritische Texte. Spinoza stellte die für die Bibelkritik typische Behauptung auf, die Bibel sei von einfachen Menschen geschrieben, voller Irrtümer und Widersprüche, über weite Strecken nicht authentisch, und das auf ihr beruhende Christentum ein vorübergehendes Phänomen.
Die steigende Verfügbarkeit übersetzter Bibeln öffnete dabei auch dem Laien die Möglichkeit, die Bibel zu studieren, und dabei stießen auch Gläubige auf Widersprüche innerhalb der Bibel sowie zwischen der Bibel und anderen antiken Überlieferungen. Archäologen, Historiker und andere Wissenschaftler versuchten die Richtigkeit oder Fehlerhaftigkeit der Bibel zu beweisen.Bisweilen haben dabei Gläubige im Bemühen, die Bibel untermauernde Fakten zutage zu fördern, im Effekt den Bibelkritikern in die Hände gespielt. So kam man z.B. auf Chronologien der ägyptischen Dynastien, die bis weit vor den angenommenen Zeitpunkt der Sintflut zurückreichten (z.B. die von Manetho). Auch von naturwissenschaftlicher Seite erwächst Kritik. Robert Hooke veröffentlichte mit Blick auf die Fossilien eine Theorie des Verschwindens der Arten, die mit der wörtlichen Auslegung des biblischen Schöpfungsplan im Widerspruch stand - was schließlich in die Evolutionstheorie von Charles Darwin mündete.
Diese, auf den Ideen der Aufklärung und Säkulariserung fußende Bibelkritik führte dazu, dass die christliche Religion bisweilen in Frage gestellt wurde (z.B. in England durch Jonathan Swift 1708: „Ich betrachte die große Menge oder die Masse des englischen Volkes als ebensolche Freidenker, das heißt als ebenso unerschütterliche Ungläubige wie die vornehmsten Kreise.“). In diese Zeit fällt auch die Auffindung eines Testaments des Klerikers Abbé Meslier, in dem eine radikale Religionskritik geäußert wurde. Viele der hier im Artikel aufgeführten Punkte finden sich auch schon in Mesliers Werk, so z.B. der Vorwurf vieler Widersprüche in der Bibel, den er zum Anlass nahm, die Bibel als ein von Menschen geschriebenes Buch aufzufassen.
Diese Sichtweisen nahmen im Zuge der Aufklärung und parallel zu Kirchen- und Religionskritik im Verlauf des 18. Jahrhunderts an Verbreitung zu. Georges Minois nennt das 18. Jahrhundert das Jahrhundert des Unglaubens.[1] Durch eine apoloegtische und doktrinäre Reaktion von Teilen der Kirche und ihrer Vertreter auf die wachsende Kritik erfuhr die Position der Kritiker noch weitere Verbreitung.
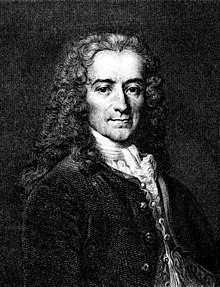
Die Aufzählung prominenter Bibel- und Religionskritiker beinhaltet viele bekannte Namen der Aufklärung, z.B. D'Holbach, Voltaire, La Mettrie, Diderot. Entsprechend dem Motto der Aufklärung gebrauchte man zunehmend den eigenen Verstand, auch bei religiösen Fragen. Man akzeptierte nicht einfach die kirchliche Doktrin, sondern forderte Nachweise, las die Bibel selbst mit einem kritischen Blick, und maß die kirchliche Lehre daran. Einmal auf diesem Kurs, machten viele nicht bei der Kritik der Bibel halt, sondern stellten die gesamte kirchliche Doktrin und Autorität und die christliche Religion in Frage, einschließlich der Existenz Gottes. Exemplarisch sei dafür der zu Ende der Aufklärung erschienene Roman „Siebenkäs“ von Jean Paul genannt, der in einer Szene Jesus selbst die Existenz Gottes verneinen lässt.
Den Schritt zum Atheismus machten jedoch viele nicht, und wandten sich stattdessen dem Deismus zu, von dem Minois schrieb, er sei „eine Warteposition für Menschen, die das Christentum [...] nicht mehr hinnehmen können, die jedoch [...] noch einen Gott brauchen“.[1] Der Deismus ist aus dieser Perspektive eine Position, welche die Bibel oder andere Offenbarungen als religiöse Quelle verwirft, und dabei zugleich am Glauben an eine Gottheit festhält. Es ist der Versuch, den Glauben an einen Gott mit eben der kritischen Vernunft in Einklang zu bringen, die gerade die Bibel demontiert hatte. Es ist auch der Versuch, einem im Atheismus gesehenen moralischen Vakuum bzw. einer Sinnleere auszuweichen (siehe dazu auch Kant und Fichte).
Im 19. Jahrhundert – im Gefolge der französischen Revolution – entstanden offen atheistische Gesellschaftsmodelle, die teils die Religion vom Staat trennen, teils die Religion ganz durch Vernunft und Wissenschaft ersetzen wollten. In diesem Klima reagierte die katholische Kirche mit trotziger Abschottung, sie beharrte ohne Abstriche auf den Dogmen und Traditionen, also auch auf der Lehre von der göttlichen Inspiration der Bibel (so z.B. auf dem Vaticanum I mit dem Dei Filius). Im Protestantismus wurde dagegen die Bibelexegese unter den Prämissen der historisch-kritischen Methode betrieben (David Friedrich Strauß), was katholische Theologen oft als Zerstörungswerk an der Bibel beargwöhnten (z.B. Lamennais). Hier wird die Überzeugung deutlich, dass die christliche Religion die Dogmen, Wunder und Mysterien brauche und die Rückführung der Religion auf die Vernunft letztlich in den Atheismus münden müsse.
Das daraus erwachsende grundlegende Problem für die Exegese beschreibt Minois: „Ein grausames Dilemma: entweder die Bibelkritik (d.h. die historisch-kritische Methode) zu akzeptieren und die Bibel zu einem gewöhnlichen Studienobjekt zu erklären, [...] auf die Gefahr hin, das übernatürliche Element zu töten, [...] was zum Unglauben führt; oder aber in aller Strenge am heiligen und inspirierten Charakter [...] festzuhalten, [...] und damit alle der Vernunft und der Intelligenz Hohn sprechenden Ungereimtheiten in Kauf zu nehmen, auf die Gefahr hin, die [...] Köpfe zu entmutigen, die sich nicht dazu durchringen können, ihre Vernunft zu opfern...“.[1]
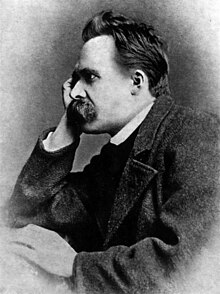
Diese Sicht der Dinge hat gerade im 19. Jahrhundert viele Christen vom Glauben abgebracht (z.B. Ernest Renan, Friedrich Engels, David Friedrich Strauß, Friedrich Nietzsche) , wirkt jedoch heute nach wie vor; heute wirkt es weiterhin (z.B. Gerd Lüdemann). Man kann davon ausgehen, dass es umgekehrt auch Einige dazu gebracht hat, eine eher evangelikale Haltung anzunehmen, die dem Dilemma in der anderen Richtung ausweicht, indem man Kritik an der Bibel gänzlich ablehnt.
Das 19. Jahrhundert markiert ebenfalls den Beginn einer Bibelkritik – und auch allgemeiner einer Religionskritik – aus psychologischer Sicht. Praktisch alle bekannten Psychologen haben sich in der einen oder anderen Form auch mit der Religion auseinandergesetzt. Die Sichtweisen sind uneinheitlich, aber eine Reihe von Psychologen können zu den Bibelkritikern gezählt werden.[2] Psychologische Betrachtungsweisen haben seither Eingang in die Theologie und die Philosophie gefunden,[3] aber es hat sich auch mit der Religionspsychologie ein eigener Forschungszweig etabliert. Teils versucht diese psychologische Bibelkritik die Bibeltexte im positiven Sinn als symbolisch zu deuten, was implizit eine wörtliche Lesart der Bibel verneint (z.B. Drewermann), teils wird aber auch auf aus psychologischer Sicht kritikwürdige Inhalte der Bibel und deren Folgen hingewiesen, und die Bibel aus diesem Grund abgelehnt (z.B. Buggle).
Moderne Bibelkritik kann verschiedene Formen annehmen. Das Spektrum erstreckt sich von offener Verunglimpfung über die Karikatur, die Satire, die Ironie, die indirekte Kritik in romanhafter oder gleichnisartiger Form, die direkte Kritik in Prosaform bis hin zu wissenschaftlichen Abhandlungen für ein spezialisiertes Publikum.
Akzeptanz der Bibelkritik
[Quelltext bearbeiten]Einige Anhänger der sich auf die Bibel als heilige Schrift beziehenden Religionen und Bekenntnisse halten Kritik an der Bibel für unzulässig oder gar eine Form von Blasphemie. Sie halten eine kritiklose und vollständige Akzeptanz der Bibel als autoritatives Wort Gottes für erforderlich. Evangelikale Strömungen pflegen diese Ansicht, die Fundamentalistische Hermeneutik und Biblizismus betreibt diesen kritiklose Umgang mit der Bibel in der Theologie.
Andererseits wird auch von bibelkritischen Theologen Forschung unter der Prämisse betrieben, als sei Gott nicht existent (etsi Deus non daretur - eine auf Hugo Grotius zurückgehende Formel). Grundlage allen Erkennens ist daher unter dieser Prämisse nicht der Glaube an einen in der Bibel sich ausdrückenden Gott als Herrn der Geschichte. Stattdessen sei die grundlegende Voraussetzung für die bibelkritische Theologie der disziplinierte, fachlich geschulte und kritische menschliche Verstand. Dieser ist die letzte Instanz in der Frage nach der Wahrheit. Diese Prämisse ist für andere Zweige der Wissenschaft ebenso gültig wie für die in diesem Sinne betriebene Bibelforschung.
In manchen Glaubensbekenntnissen bleibt die Interpretation den religiösen Autoritäten vorbehalten, die vom Gläubigen angenommen werden muss (z. B. in der Römisch-Katholischen Kirche untersteht „alles das nämlich, was die Art der Schrifterklärung betrifft, ... letztlich dem Urteil der Kirche, die den göttlichen Auftrag und Dienst verrichtet, das Wort Gottes zu bewahren und auszulegen“[4]), überlassen andere Bekenntnisse (z. B. die der Evangelischen Kirche) diese Interpretation dem Einzelnen, der sich dazu gegebenenfalls auch des Gebets, der Meditation, und der Konsultation weiterführender Literatur und religiöser Autoritäten bedient (Martin Luther: „sola scriptura“).
Bibelkritik im Spiegel des Bibelverständnisses
[Quelltext bearbeiten]Augenscheinliche Widersprüche zwischen Aussagen der Bibel und Widersprüche zu Ergebnissen von naturwissenschaftlicher und historischer Forschung werden abhängig vom Bibelverständnis interpretiert:
Irrtumslosigkeit
[Quelltext bearbeiten]Betrachtet man die Bibel als göttlich inspiriert, inhaltlich korrekt und irrtumslos, so werden augenscheinliche Widersprüche an einer falschen Interpretation festgemacht. Wenn Erkenntnisse aus den Wissenschaften der Bibel entgegenstehen, so werden diese abgelehnt.
Noch heute begreift ein großer Teil der evangelikalen Bewegung die Bibel als Geschichtsbuch und betont, dass „die Bibel absolut irrtumslos und unfehlbar“ sei. [5] Die „Chicago Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift“ von 1978, betont, „dass die Schrift in ihrer Gesamtheit irrtumslos und damit frei von Fehlern, Fälschungen oder Täuschungen ist.“ [6]; dies umfasse auch naturwissenschaftliche Aussagen (Biblischer Fundamentalismus).
Eine weniger radikale Position lässt die Bibel zwar göttlich inspiriert, aber von Menschen verfasst sein, wodurch augenscheinliche Widersprüche im Kontext der menschlichen Fehlbarkeit stehen; der göttlich inspirierte Kern wird jedoch nicht in Frage gestellt. Daraus ergibt sich die Problematik, die göttliche Inspiration vom Menschenwerk zu trennen. Hier entsteht ein Interpretationsbedarf, der z.B. von der römisch-katholischen Kirche als eigenes Vorrecht reklamiert wird. Es entsteht so auch ein reichhaltiges Feld, auf dem sich die verschiedenen Konfessionen voneinander absetzen können, indem sie die Bibel auf verschiedene Weise interpretieren. Solche Meinungsverschiedenheiten haben praktisch alle Schismen und Abspaltungen in der Geschichte der christlichen Kirche begleitet.
Gegenüber der Position der Irrtumslosigkeit besteht hier eine größere Bereitschaft in der Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Menschenwerk
[Quelltext bearbeiten]Die Auffassung, die Bibel sei reines Menschenwerk, ist heute unter aufgeklärten Christen weit verbreitet. Damit wird nicht automatisch die Stellung der Bibel als heilige Schrift zurückgewiesen. Vielmehr erkennt man ihre formale Zeitgebundenheit und fordert die inhaltliche Interpretation für die Moderne.
Rezeption der Bibelkritik im Christentum
[Quelltext bearbeiten]Die meisten Argumente der Bibelkritiker sind implizit oder explizit auch als Argument gegen die göttliche Inspiration oder die Irrtumslosigkeit zu verstehen.[7] Für Anhänger der göttlichen Inspiration kann ein Hinweis auf einen Widerspruch den Charakter einer grundsätzlichen Kritik an der Bibel oder am Christentum erwecken.
Eine Vielzahl von Christen betrachtet die Bibel aus einem aufgeklärten Standpunkt heraus:
- Weit verbreitet ist die Auffassung, dass die Schöpfungsgeschichten sowie die Geschichten von der Sintflut und vom Turmbau zu Babel keine Tatsachenberichte seien, sondern Glaubensaussagen, eingekleidet in naturkundliche und mythologische Vorstellungen ihrer Entstehungszeit.
- Diese Auffassung lässt sich auch auf weitere Teile der Bibel ausdehnen, z. B. auf die Geschichten von den Erzvätern Abraham, Isaak und Jakob. Teilweise wird für die Tatsachenberichte in der Bibel darauf hingewiesen, dass sich im Laufe der bis zu dreitausendjährigen Überlieferung Ungenauigkeiten und Fehler eingeschlichen haben könnten.
- Die Katholische Kirche lehrt: „[...] ist von den Büchern der Schrift zu bekennen, dass sie sicher, getreu und ohne Irrtum die Wahrheit lehren, die Gott um unseres Heiles willen in heiligen Schriften aufgezeichnet haben wollte“ (Katechismus der Katholischen Kirche, Absatz 107). Dies kann so interpretiert werden, dass Irrtumslosigkeit nur für Glaubensaussagen in Anspruch genommen wird, aber nicht unbedingt für naturwissenschaftliche und historische Tatsachenbehauptungen.
- Einige Theologen, unter ihnen Rudolf Bultmann, befürworten eine weitgehende Entmythologisierung der Bibel. Sie erklären bestimmte Geschichten als Mythen, die nicht zur Überlieferung von Tatsachen bestimmt seien, sondern zur Verkündigung von Glaubensinhalten.
Kritik der ethischen Vorstellungen
[Quelltext bearbeiten]Bibelkritiker sehen Widersprüche zwischen den ethischen Vorstellungen in der Bibel und denen aus der modernen Zeit, wie sie z. B. in den Menschenrechten zum Ausdruck kommen. Franz Buggle kritisiert diesen Umstand[8]. In dieser Diskussion geht es um die Frage, inwiefern die Bibel Grundlage für eine zeitgemäße Ethik sein kann (Theologische Ethik).
Bibelkritiker gründen ihre Ethik oft ohne Rückgriff auf die Bibel auf humanistischen Idealen und kritisieren dann ausgehend von dieser Position die ethischen Maßstäbe der Bibel. Dem liegt die Überzeugung zugrunde, dass die Ethik keines religiösen Fundaments bedürfe, und sich ethische Maßstäbe aus der Vernunft und/oder dem Sozialgefüge herleiten ließen.[9] Auf der Grundlage dieser Maßstäbe wird biblische Ethik kritisierbar. Wer dagegen die Bibel als Grundlage der Ethik betrachtet, hat keinen unabhängigen Maßstab, anhand dessen die biblische Ethik kritisiert werden könnte - die Bibel ist selbst der Maßstab. Hier kann man dann allenfalls die innere Konsistenz der biblischen Ethik untersuchen.
So ergeben sich zwei verschiedene Arten der Ethikkritik:
- Kritik an der inneren Konsistenz der biblischen Ethik. Hier stellt sich insbesondere die Frage inwieweit die ethischen Aussagen des neuen Testaments mit denen des Alten Testaments im Widerspruch stehen. („Liebet eure Feinde“ (Lk 6,27-28 EU) im Neuen Testament, „du sollst an ihnen [Anm.: den Feinden] unbedingt den Bann vollstrecken“ (Dtn 20,16-17 EU) im Alten Testament)
- Kritik an der Konsistenz der biblischen Ethik mit anderen Ethikansätzen, besonders derjenigen, die auf den Humanismus zurückgehen.
Patriarchat, Vorrang des Mannes vor der Frau im Alten Testament
[Quelltext bearbeiten]Viele Bibelkritiker werfen dem Alten Testament eine durchweg patriarchale Einstellung vor. Die Formung der Frau aus der Rippe des Mannes in der zweiten Schöpfungsgeschichte (1 Mos 2,18ff EU) wird dabei als eine Umkehrung der biologischen Verhältnisse aufgefaßt.[10] Mit folgenden Indizien wird eine Unterordnung der Frau unter den Mann im AT festgemacht:[11]
- Priester sind grundsätzlich männlich.
- Auch Gott selbst trägt meistens männliche Züge.[12]
- Stammbäume werden über die männliche Linie angegeben, die Frauen spielen dabei nur eine geringe Rolle (z.B. 1 Chr 1-9 EU). Auch bei der Angabe der Nachkommenschaft werden Töchter üblicherweise übergangen (z.B. 2 Sam 3,2ff EU).
- Ein Mann kann mehrere Frauen und Nebenfrauen haben, aber nicht umgekehrt (5 Mos 21,15f EU, 5 Mos 25,5ff EU).[13]
- Töchter würden als Eigentum der Väter, Ehefrauen als Eigentum der Ehemänner betrachtet (1 Mos 29,16ff EU).
- Eine Frau ist nach der Geburt einer Tochter doppelt so lange unrein wie nach einem Sohn (3 Mos 12 EU).
- Faßt eine Frau im Streit einem Mann an die Geschlechtsteile, soll ihr die Hand abgehackt werden (5 Mos 25,11f EU). Ein entsprechendes umgekehrtes Gebot ist nicht vorhanden.
- Frauen würden als schwächer und unzuverlässiger dargestellt, Verräter wären oft weiblich (Nah 3,13 EU, Jos 2 EU, Ri 16 EU).
- In der Geschichte der Benjaminiter von Gibea (Ri 19 EU) wird eine Nebenfrau von ihrem Mann einer Gruppe von Männern zur Vergewaltigung überlassen, nachdem diese mit der Vergewaltigung seiner Gäste drohten. Dies schildert die Bibel allerdings als Skandal, der zu einem Krieg führte.
Andererseits stehen Frauen auch mehrfach als positive Heldinnen im Mittelpunkt des Geschehens, so z.B. Debora, Ruth und Ester.
Häufig wird versucht den Vorwurf des Patriachats durch den allgemeinen Zeitgeist der Antike zu entkräften. In der Tat kamen solche Vorstellungen zu jener Zeit auch in anderen Gesellschaften als der jüdischen vor. Es gab jedoch auch damals bereits verschiedene Gesellschaften, in denen Frauen ein größeres Ausmaß an persönlicher Freiheit und Gleichberechtigung genossen.[14][15]
Frauenbild und Sexualität im Neuen Testament
[Quelltext bearbeiten]Jesus zeigt Frauen gegenüber mehr Milde und Offenheit (Joh 8,3ff EU, Joh 4,7-29 EU). Zudem beschneidet er die Rechte der Männer (z.B. Mt 5,27f EU, Mt 5,31f EU, Mt 19,3ff EU), was darauf hindeutet, dass sie ihre Rechte zu freizügig ausgenutzt hatten. Jesus hatte besonders viele Frauen unter seinen Anhängern.
Paulus betont eine traditionelle Sichtweise (1 Kor 11,7-12 EU, 1 Kor 14,33ff EU, Eph 5,24 EU). Es wird hier deutlich, dass Paulus die Schöpfungsgeschichte bewusst patriarchalisch auslegt. Auch Petrus vertritt eine Haltung die mehr an der jüdischen Tradition orientiert ist (1 Petr 3,1-7 EU). Ein Gegensatz der Haltungen von Jesus und Paulus wird von Kritikern immer wieder vorgeworfen, und die Haltung der Kirchenväter und der christlichen Kirche wird in der Tradition von Paulus gesehen. Paulus wird dabei vorgeworfen, zum Teil die Strenge der jüdischen Traditionen zu übertreffen.[16][17]
Literatur
[Quelltext bearbeiten]Bibelkritik
[Quelltext bearbeiten]- Franz Buggle: Denn sie wissen nicht, was sie glauben. Alibri, Aschaffenburg 2004, ISBN 3-932710-77-0
- Israel Finkelstein, Neil Asher Silberman: Keine Posaunen vor Jericho. Die archäologische Wahrheit über die Bibel. Beck, München 2002, ISBN 3-406-49321-1
- Karlheinz Deschner: Abermals krähte der Hahn. Eine kritische Kirchengeschichte. 5. Aufl., btb, München 1996, ISBN 3-442-72025-7
- Karlheinz Deschner: Der gefälschte Glaube. Eine kritische Betrachtung kirchlicher Lehren und ihrer historischen Hintergründe. Knesebeck, München 2004, ISBN 3-89660-228-4
- Rudolf Augstein: JESUS Menschensohn. 3. Aufl., dtv, München 2003, ISBN 3-423-30822-2
- Uta Ranke-Heinemann: Nein und Amen. Mein Abschied vom traditionellen Christentum. 4. Aufl., Heyne, München 2004, ISBN 3-453-21182-0
- Norbert Rohde: Abschied von der Bibel. Books on Demand, Norderstedt 2004, ISBN 3-8334-1577-0
- Johannes Maria Lehner: Und die Bibel hat doch NICHT Recht. Historia, Ulm 2005
- Voltaire: La Bible enfin expliquée. (um 1776)
- William Henry Burr: Self-Contradictions of the Bible. Prometheus Books, Amherst, ISBN 1-57392-233-1
- C. Dennis McKinsey: The Encyclopedia of Biblical Errancy. Prometheus Books, Amherst 1995, ISBN 0-87975-926-7
- Walter-Jörg Langbein: Lexikon der biblischen Irrtümer. Von A wie Auferstehung Christi bis Z wie Zeugen Jehovas. Langen/Müller, München 2003, ISBN 378442922X
- Walter-Jörg Langbein: Lexikon der Irrtümer des Neuen Testaments. Langen/Müller, München 2004, ISBN 3784429750
- Hartmut Krauss (Hrsg.): Das Testament des Abbé Meslier. Hintergrund Verlag, Osnabrück 2005, ISBN 3-00-015292-X
Verteidigungsschriften
[Quelltext bearbeiten]- Craig Blomberg: Die historische Zuverlässigkeit der Evangelien. 1998, ISBN 3-933372-16-X
- Josh McDowell: Die Bibel im Test. Tatsachen für die Wahrheit der Bibel. 9. Aufl., CLV: Bielefeld 2002, ISBN 3-89397-490-3 (online, PDF)
- Josh McDowell: Die Fakten des Glaubens. Die Bibel im Test. Fundierte Antworten auf herausfordende Fragen an das Wort Gottes, Holzgerlingen 2003, ISBN 3-89397-623-9
- Werner Gitt: So steht's geschrieben. Zur Wahrhaftigkeit der Bibel. 4. Aufl., ISBN 3775117032
- Stephan Holthaus; Karl-Heinz Vanheiden (Hrsg.): Die Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit der Bibel, ISBN 3-933372-38-0
- Eta Linnemann: Gibt es ein synoptisches Problem? VTR: Nürnberg 1999, ISBN 3-933372-15-1
- Eta Linnemann: Bibelkritik auf dem Prüfstand. 2. Aufl., VTR Verlag für Theologie und Religionswissenschaft: Nürnberg 2001, ISBN 3-933372-19-4 (Zusammenfassung)
- Eta Linnemann: Original oder Fälschung. Historisch-kritische Theologie im Licht der Bibel. CLV-Verlag (1994), ISBN 3-89397-754-6 (pdf-Download)
- Vittorio Messori: Gelitten unter Pontius Pilatus? Eine Untersuchung über das Leiden und Sterben Jesu. Adamas-Verlag, 1997, ISBN 3925746722
- Ralph O. Muncaster: Prüfe die Beweise: Wissenschaft - war die Bibel ihrer Zeit voraus?, Hamburg, 2003, ISBN 3-931188-55-8 (Buch eines ehemaligen Bibelkritikers)
- Alfons Sarrach: Jahrhundert-Skandal. Von der unhaltbaren Kritik an den Evangelien. Miriam: Jestetten 2003, ISBN 3-87449-323-7
- D. Rhoton: Die Logik des Glaubens: Argumente, Denkanstöße, Neuhausen-Stuttgart: Hänssler, 9. Aufl., 1993, ISBN 3-7751-1174-3 (mit Abschnitten zur Kritik an den Wundern Jesu, seiner Auferstehung, der Genauigkeit der Bibel usw.)
- Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft: Die Bibel - Gottes oder Menschenwort, 1989
- Uwe Zerbst; Peter van der Veen (Hrsg.): Keine Posaunen vor Jericho? Beiträge zur Archäologie der Landnahme, Hänssler-Verlag: Holzgerlingen, 2005, ISBN 3775144196 (Inhaltsverzeichnis und Leseprobe)
Weblinks
[Quelltext bearbeiten]Bibelkritische Links
[Quelltext bearbeiten]- Bibelkritik und Zweifel
- Kreudensteins Atheistenseite/ Bibelkritik
- Texte zu Religion-Bibel-Philosophie, Website Klaus Windhöfel
- Bibelkritik/ Kritische Stimmen zur Bibel
- Widersprüche in der Bibel (Zitatsammlung von Bibelzitate.de)
- Fehler in der Bibel (Zitatsammlung von Bibelzitate.de)
- (kritischer) Artikel über die Bibel/ Leseproben von Karlheinz Deschner
- Bibelkritik aus der Sicht der Freien Christen
- Die Bibel kritisch betrachtet (englischsprachig)
Reaktionen auf Bibelkritik
[Quelltext bearbeiten]- Begriffslexikon: BIBEL-KRITIK - Was kann man unter dem Begriff alles verstehen?
- Gottfried Schröter: Und die intellektuelle Redlichkeit? Kommentar zu einem Spiegel-Interview mit Andreas Lindemann
- Miachel Kotsch: Wie Chrischona, Liebenzell und Tabor mit Bibeltreue umgehen
- Armin Baum: Glaube, Geschichte und die neutestamentliche Wissenschaft
- Nikodemus.net: Fehler im Alten Testament?
- Inhaltliche Auseinandersetzung mit den Theorien der Bibelkritiker
- Rolf J. Pöhler: Historische und kritische Überlegungen zur historisch-kritischen Methode
- Bibelcenter.de - Lösungen zu (scheinbaren) Widersprüchen in der Bibel
- Aufsatz von S. Isenberg: Widersprüche in der Bibel?
Einzelnachweise
[Quelltext bearbeiten]- ↑ a b c Siehe Georges Minois: Die Geschichte des Atheismus
- ↑ Prominente Beispiele sind hier z.B. Sigmund Freud und C.G. Jung, auch unter den zeitgenössischen Bibelkritikern finden sich viele Psychologen, z.B. Franz Buggle und Gerhard Vinnai.
- ↑ Siehe z.B. Friedrich Schleiermacher, William James, oder heutzutage Eugen Drewermann. Das Verhältnis zwischen Theologie und Psychologie ist allerdings nach wie vor von Spannungen geprägt, was sich exemplarisch an Drewermanns Lebenslauf ablesen lässt.
- ↑ Katechismus der Katholischen Kirche, Absatz 119
- ↑ Johannes Vogel, Breckerfeld; in: idea-Pressedienst 46/004
- ↑ http://www.efg-hohenstaufenstr.de/downloads/bibel/chicagoerklaerung-artikel.htm zitiert nach idea-Pressedienst 25/2003
- ↑ Siehe z.B. Robert Green Ingersoll: A Few Reasons for Doubting the Inspiration of the Bible. (auf Englisch)
- ↑ Franz Buggle, Denn sie wissen nicht, was sie glauben, Rowohlt 1997, ISBN 3499604272, Alibri 2004, ISBN 3932710770
- ↑ Die Ansicht, die Ethik bedürfe eines religiösen Fundamentes, oder genauer gesagt eines Regeln gebenden Gottes, ist weit verbreitet. Sie findet Ausdruck im Dostojewski zugeschriebenen Ausspruch „Ohne Gott ist alles erlaubt.“ Es ist jedoch durchaus möglich, eine Ethik auch ohne Rückgriff auf religiöse Vorstellungen oder Offenbarungen zu entwickeln. Siehe dazu z.B. Mackie: Ethik. Angesichts von häufig vorkommenden religiös motivierten Gewalttaten wird die prinzipielle Überlegenheit religiös begründeter Ethiken auch immer wieder bestritten.
- ↑ Z.B. Erich Fromm: „Der biblische Schöpfungsmythos beginnt dort, wo der babylonische Mythos endet ... Im Gegensatz zu den Tatsachen wird der Mann nicht durch die Frau geboren, sondern die Frau wird aus dem Manne geschaffen.“ (Das Christusdogma, S. 115f)
- ↑ Siehe dazu auch Karlheinz Deschner Das Kreuz mit der Kirche, Kap. 4
- ↑ Zu den Ausnahmen gehören Jes 66,13 EU, 49,15 EU, evtl. auch 5 Mos 32,18 EU.
- ↑ Bei manchen Königen spricht die Bibel von einer großen Zahl von Frauen und Nebenfrauen, z.B. bei Salomo (1 Kön 11,3 EU). Auch sein Vater David hatte viele Nebenfrauen (1 Chr 14,3 EU, 2 Sam 20,3 EU, 2 Sam 5,13 EU)
- ↑ Im direkten jüdischen Blickfeld war die Situation in Ägypten, wo Frauen schon in pharaonischer Zeit die freie Partnerwahl hatten, und auch sonst große Autonomie. Siehe dazu z.B. Peter H. Schulze Frauen im alten Ägypten, ISBN 3404641191
- ↑ In der griechischen Mythologie und Geschichte kommen Frauenfiguren öfter in einer durchaus autonomen und selbstbewußten Lage vor, wie z.B. die Amazonen, diverse Göttinengestalten wie Hera oder Athene, oder auch Sappho und ihre Schülerinnen auf Lesbos. In Sparta waren Frauen zwar nicht gleichgestellt, genossen aber etliche Rechte, die einer Jüdin nicht zustanden, wie z.B. Besitz- und Erbrechte.
- ↑ Simone de Beauvoir: „Die christliche Ideologie hat nicht wenig zur Unterdrückung der Frau beigetragen. [...] Die leidenschaftlich antifeministische Tradition des Judentums lebt im Apostel Paulus fort. Der hl. Paulus gebietet den Frauen unauffällige Zurückhaltung; auf das alte und das neue Testament gründet er das Prinzip der Unterordnung der Frau unter den Mann.“ (Das andere Geschlecht, Buch 1 Teil 2 Kap. IV)
- ↑ Karlheinz Deschner stellt in Das Kreuz mit der Kirche die beiden Positionen gegeneinander (Kap. 6&7). „An Jesus hat die christliche Askese keine Stütze. Zölibat, Frauen- und Ehediskriminierung, die Fasten- und anderen Kasteiungspraktiken vertritt er so wenig wie Militarismus oder Ausbeuterei. [...] Es fällt nicht schwer, sich die Radikalität vorzustellen, mit der Jesus das Triebleben verdammt hätte, wäre es ihm darum zu tun gewesen. Doch pflegte er Umgang selbst mit Sündern und Huren. [...] Mit Frauen verkehrte Jesus in voller Freiheit. Er hielt sie nicht für minderwertig und setzte sie nirgends zurück“ und „Paulus [...] induzierte nicht nur eine Reihe scharf antijesuanischer, das Christentum recht eigentlich erst begründender Dogmen, sondern führte auch schon die Diffamierung der Sexualität ein, die Zurücksetzung der Frau, die Geringschätzung der Ehe und die Askese. [...] Mit solchen Attacken gegen die Lust [...] sinkt Paulus noch unter das Judentum seiner Zeit“