Schulprogramm (historisch)




Ein Schulprogramm war im 19. und frühen 20. Jahrhundert eine von einer höheren Schule jährlich herausgegebene gedruckte Veröffentlichung, die den Jahresbericht der Anstalt in der Regel mit einer wissenschaftlichen Abhandlung verband und durch Austausch unter den Schulen verbreitet wurde. Die Schulprogramme stellen in Deutschland eine einzigartige und herausragende Quelle für die Erforschung der Entwicklung des Schulwesens dar.
Entstehung
Die Schulprogramme gingen aus den Einladungen von Lehranstalten zu den alljährlichen Prüfungen und Vorträgen, den Vorläufern des Abiturs, hervor. Solche gedruckten Einladungsschriften sind bereits aus dem Ende des 16. Jahrhunderts bekannt.[2] Im 18. Jahrhundert wurde es darüber hinaus zunehmend üblich, dass ein Gymnasium Academicum auch zu einzelnen besonderen Lehrveranstaltungen Einladungen drucken ließ, da diese nicht selten öffentlich waren. Das Lehrprogramm des jeweiligen Schuljahres wurde in gedruckten Heften tabellarisch aufgeführt und mit Erläuterungen versehen. Oft wurden diese Veranstaltungskalender auch durch lateinisch abgefasste Abhandlungen ergänzt, in denen die Professoren sich mit den Gegenständen ihrer Lehre befassten und ihre wissenschaftliche Exzellenz zu zeigen trachteten. Diese Publikationen wurden gesammelt und, in chronologischer Folge gebunden, als Opusculi Professorum aufbewahrt.
1824 machte ein Erlass des Kultusministeriums, die Gymnasial-Prüfungsprogramme betreffend, für alle preußischen Gymnasien zur Pflicht, regelmäßig Rechenschaft über die geleistete Arbeit, die Inhalte der Lehre und die Prüfungen abzulegen in Form von Programmen, die einmal im Jahr veröffentlicht werden sollten. Kurz darauf wurde ein landesweiter Austausch organisiert, dem sich schon 1831 die Freien Städte Frankfurt am Main und Lübeck, 1836 Sachsen und weitere Staaten anschlossen.
Die Programme dienten dem gegenseitigen Wissens- und Erfahrungsaustausch und der Fortbildung. Außerdem waren sie ein Mittel der Öffentlichkeitsarbeit. Daneben konnte die preußische Schulaufsicht durch sie eine gewisse Vereinheitlichung erreichen. Nach dem preußischen Vorbild wurden im 19. Jahrhundert auch in Österreich Jahresberichte eingeführt.[3]
Aufbau
In den folgenden Jahrzehnten erhielten die Schulprogramme einen einheitlichen Aufbau, der für Preußen folgendermaßen vorgegeben war:
- Abhandlung über ein wissenschaftliches Thema vom Direktor oder einem Mitglied des Lehrkörpers (bis 1872 verpflichtend, dann fakultativ als Beilage)
- Schulnachrichten
- I. Lehrverfassung;
- A. Lehrplan für das Schuljahr;
- a. Allgemeiner Lehrplan;
- b. Verteilung der Fächer auf die einzelnen Lehrer
- c. Spezieller Lehrplan der Klassen
- A. Lehrplan für das Schuljahr;
- B. Übersicht über die erlassenen Verfügungen von allgemeinem Interesse
- II. Chronik des verflossenen Schuljahres
- III. Statistische Nachrichten
- A. Curatorium und Lehrer-Kollegium der Anstalt
- B. Frequenz der Anstalt / Namen der Abiturienten
- C. Stand des Lehrapparates
- D. Etat der Anstalt
- IV. Stiftungen der Schule
- V. Besondere Mitteilungen an die Eltern[4]
Im Gegensatz zum heutigen so genannten Schulprogramm sind die Programme des 19. Jahrhunderts nicht Zielvorstellungen und Profilbeschreibungen für die zukünftige Entwicklung einer Schule, sondern Rechenschaftsberichte über das zurückliegende Schuljahr; allerdings ist auch auf diese Weise das Schulprofil deutlich erkennbar. Am ehesten sind die Schulprogramme noch mit den Yearbooks amerikanischer Schulen und Colleges vergleichbar.
Seit 1899 hießen die Programme offiziell nur noch Jahresberichte, eine Namensänderung, die sich nur langsam durchsetzte, allerdings den Begriff Schulprogramm für diese Berichte bis heute nicht hat verdrängen können. Auch die weit älteren Vorlesungsanzeigen werden in der Literatur längst als Schulprogramme geführt.
Erfolg und Krise
Die Idee zur Vereinheitlichung und zum Austausch der Schulprogramme wirkte sich sowohl positiv als auch negativ aus.
Schon 1860 nahmen 350 Anstalten am Austausch teil; 1869 verfügten manche Schulen schon über 10.000 Exemplare. Obwohl 1872 die bis dahin geltende Pflicht zur Aufnahme einer Abhandlung in die Möglichkeit ihrer Beigabe umgewandelt wurde, waren die Behörden mit dem Austausch zunehmend überfordert. Daher wurde der Austausch 1876 dem Verlag Teubner in Leipzig übergeben, der ihn mit großem logistischen Einsatz bis 1916 weiterführen konnte. Um diese Zeit waren, so schätzt C. Struckmann, bei kontinuierlicher Sammeltätigkeit „an einer preußischen Schule maximal 50000 Programme vorhanden“.[5]
Der ursprüngliche Ansatz, nämlich eine Plattform für Fortbildung und pädagogischen Austausch zu schaffen, ging in dieser gewaltigen Menge unter. Hinzu kamen Probleme bei der Archivierung und Katalogisierung. Während diese in einigen Schulen nach den Schulorten (Provenienzprinzip) erfolgte, geschah dies andernorts nach den Themen der Abhandlungen (Pertinenzprinzip), was die Geschlossenheit der Überlieferung zerstörte. Einige Schulen verzichteten ganz auf eine Katalogisierung, was das gesamte Material unzugänglich machte.
In vielen Fällen wurde dieser Altbestand zunehmend als Belastung empfunden. Eine Verordnung von 1943 erklärte die Schulprogramme für „zweifellos meistens entbehrlich“ und ordnete die Überweisung in die Altmaterialsammlung an.[6]
Was diese Aussonderung überlebte, landete oft in den 1960er Jahren im Müll oder im antiquarischen Buchhandel. Die heute umfangreichste Sammlung an Schulprogrammschriften in der Justus-Liebig-Universität Gießen entstand durch den Ankauf von 12.000 Exemplaren aus dem Antiquariatshandel im Jahre 1969.
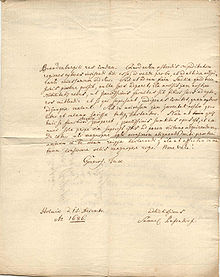

Bedeutung
Bedingt auch durch die schlechte bibliographische Zugänglichkeit, setzte sich die Einsicht in den Quellenwert der Schulprogramme erst nach und nach durch. Im Vorwort zum Katalog der Sammlung in der Lübecker Stadtbibliothek heißt es dazu, Schulprogramme seien „eine der vornehmsten Quellengattungen für Forschungen auf den Gebieten Schulgeschichte, Geschichte der Pädagogik, historische Bildungssoziologie, Schulvolkskunde und Ideologiegeschichte“.[9]
Die Abhandlungen geben einen reichen Einblick in die weitgestreuten wissenschaftlichen Interessen des Lehrpersonals. Sie machen deutlich, welchen hohen Anspruch vor allem die Gymnasien vertraten. Doch boten sie ebenso oft – vor allem, bevor es entsprechende Zeitschriften gab – eine Plattform z. B. für lokalhistorische und pädagogische Abhandlungen und spiegeln zeitgemäße Bewegungen in der Wissenschaftslandschaft wider, so etwa die Einführung moderner Fremdsprachen wie Französisch[10] und Englisch[11] oder den rasanten Aufstieg der Naturwissenschaften in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.[12]
Einige Schulprogramm-Abhandlungen haben unterdessen sogar besondere wissenschaftliche Bedeutung erlangt, etwa wenn sie zwischenzeitlich nicht ersetzte Editionen entlegener, auch literarischer Texte enthalten. So edierte zum Beispiel Alfred Puls 1898 ein Niederdeutsches Gebetbuch aus dem 14. Jahrhundert im Rahmen der wissenschaftlichen Beilage[13], und Johann Claußen gab 1904 und 1906 in Schulprogrammen die Briefe des Philologen Johannes Caselius, geschrieben 1589, heraus.[14] Christian Heinrich Postels und Jacob von Melles Beschreibung einer Reise ... nach den Niederlanden und England im Jahre 1683 wurde erstmals 1891 in einem Lübecker Schulprogramm ediert.[15]
Die eigentlichen Jahresberichte sind eine Fundgrube für sonst nur schwer erhebbare Daten und Fakten und stellen für einige Schulen, beispielsweise für die der deutschen Ostgebiete, nach Kriegszerstörung deren einzige Überlieferung dar, insbesondere durch die von den preußischen Instrukteuren in den Schulprogrammen geforderten chronistischen Anteile. In einigen glücklichen Fällen, die indes im wesentlichen westdeutsche Anstalten betreffen, konnten nach dem Ende der Rechenschaftspflicht die Chroniken der Schulen und die Berichte über das Geleistete in anderen Publikationen weitergeführt werden, z. B. in den Veröffentlichungen von Freundes- und Fördervereinen der Gymnasien.
Überlieferung
Umfangreiche Bestände an Schulprogrammen finden sich neben den schon erwähnten Sammlungen in Gießen und Lübeck vor allem in der zentralen preußischen Sammlung der früheren Reichsstelle für Schulwesen in Berlin, seit 1997 in der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung, sowie in der Bibliothek der Franckeschen Stiftungen in Halle (Saale).
Eine Reihe von Schulprogrammen liegt mittlerweile auch digitalisiert vor.
Literatur
- Siegrid Kochendörfer, Elisabeth Smolinski, Robert Schweitzer: Katalog der Schulprogrammsammlung der Stadtbibliothek Lübeck. Bibliothek der Hansestadt Lübeck, Lübeck 2000 (Veröffentlichungen der Stadtbibliothek Lübeck: Reihe 3; 12: Verzeichnisse), ISBN 3-933652-10-3.
- Franz Kössler: Verzeichnis von Programm-Abhandlungen deutscher, österreichischer und schweizerischer Schulen der Jahre 1825–1918 : alphabetisch geordnet nach Verfassern. 5 Bände, Saur, München/London/New York/Paris 1987–1991, ISBN 3-598-10665-3.
- Freidank Kuchenbuch: Über alte Stendaler Schulprogramme. In: 600 Jahre Gymnasium zu Stendal 1338–1938. Festschrift 1938; S. 149ff. (Mit einer Bibliographie Stendaler Schulprogramme vom 17. Jahrhundert bis 1825) (Digitalisat).
- Richard Ullrich: Programmwesen und Programmbibliothek der Höheren Schulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Übersicht der Entwicklung im 19. Jahrhundert und Versuch einer Darstellung der Aufgaben für die Zukunft. Weidmann, Berlin 1908. (Erweiterter Abdruck aus der Zeitschrift für das Gymnasialwesen Bd 61 1907) (Digitalisat).
Weblinks
- Umfassende kommentierte Linkliste der Universitätsbibliothek Giessen zu Schulprogrammschriften und Sekundärliteratur im Internet
- Digitalisierte Volltexte von ausgewählten Schulprogrammen der Universitätsbibliothek Giessen
- Austrian Literature Online, digitalisierte Jahresberichte österreichischer Schulen
- Warendorfer Schulprogramm von 1594
Anmerkungen
- ↑ Die offizielle Homepage der Stadt liefert Hinweise auf diese Bildungseinrichtung, polnisch
- ↑ vgl. Kuchenbuch (1938) S.149
- ↑ Die auf diesem Weg zugänglichen diesbezüglichen Quellen sind indes schwer zu sichten, da die Katalogisierung zwecks Verbesserung offen ist für Eingriffe, aber, wie es scheint, nicht hinreichend gepflegt wird. Die Berichte eines Wiener Gymnasiums sind hier einzusehen.
- ↑ nach: Michael Morkramer: Ostendorf-Gymnasium Lippstadt: 150 Jahre Lippstädter Schulprogramme. Digitalisat
- ↑ Caspar Struckmann: Schulprogramm und Jahresprogramme: Zur Geschichte einer wenig bekannten Schriftenreihe (Dgitalisat), S. 6.
- ↑ Struckmann, S. 6
- ↑ Johann Claußen: Ein Brief Samuel von Pufendorfs. Programm des Christianeums zu Altona, 1906
- ↑ Weder der verlinkte WP-Artikel noch die offizielle Homepage der Stadt liefern irgendeinen Hinweis auf höhere Schulen, geschweige denn auf derartige Bildungseinrichtungen in der Vergangenheit; eine Recherche über die gängigen Suchmaschinen im Internet ist erfolglos.
- ↑ zitiert nach der Rezension des Katalogs
- ↑ Vgl. dazu die Schriften Konrad Dietrich Haßlers
- ↑ Vgl. Sabine Doff: Englischlernen zwischen Tradition und Innovation. Fremdsprachenunterricht für Mädchen im 19. Jahrhundert. München: Langenscheidt-Longman 2002. Schulprogrammschriften waren eine der wichtigsten Quellen dieser Dissertation.
- ↑ Einen tabellarischen Überblick über behandelte Themen bietet Struckmann, S. 4
- ↑ Alfred Puls: Niederdeutsches Gebetbuch, aus der Pergamenthandschrift des Königlichen Christianeums zu Altona. Herausgegeben 1898
- ↑ Johann Claußen: 36 Briefe des Philologen Johannes Caselius, geschrieben zu Rostock im April und Mai 1589, aus einer Handschrift der Gymnasialbibliothek. Herausgegeben im Schulprogramm des Christianeums zu Altona 1900; ders.: 39 Briefe des Philologen Joh. Caselius, geschrieben zu Rostock 1589. Herausgegeben im Schulprogramm des Christianeums zu Altona 1904
- ↑ Beschreibung einer Reise...nach den Niederlanden und England im Jahre 1683 von Jacob von Melle und Christian Heinrich Postel, hrsg. Carl Curtius, Schulprogramm des Katharineums. Lübeck 1891