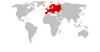Bundesverfassung (Österreich)
Die Bundesverfassung von Österreich ist die Gesamtheit aller Verfassungsgesetze und -bestimmungen des Bundesrechtes. Die zentralen Bestimmungen des Bundesverfassungsrechtes enthält dabei das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG). Daneben stehen auch noch zahlreiche andere Gesetze oder einzelne Gesetzesbestimmungen sowie Staatsverträge im Verfassungsrang. Das österreichische Bundesverfassungsrecht weist insgesamt eine große Unübersichtlichkeit auf.
Geschichte
Erste Republik
Bundes-Verfassungsgesetz 1920
Das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) wurde am 1. Oktober 1920 von einer Konstituierenden Nationalversammlung beschlossen, welche aus den ersten demokratischen Wahlen in Österreich hervorgegangen war. Die Entwürfe hierzu erstellten der Rechtsphilosoph und Staatsrechtler Hans Kelsen, der Christlichsoziale Politiker Michael Mayr und der damalige Staatskanzler Karl Renner. Das B-VG wurde im Staatsgesetzblatt unter Nr. 450 sowie im Bundesgesetzblatt (BGBl.) unter Nr. 1 kundgemacht und trat in den wesentlichen Teilen am 10. November 1920 in Kraft. Das österreichische B-VG ist somit eine der ältesten heute noch in Geltung stehenden Verfassungen Europas.
Das B-VG war jedoch von Anbeginn ein Torso, da die Parteien der jungen Republik in einer Reihe von wichtigen Punkten keine Einigung erzielen konnten. Dies betraf insbesondere den Bereich der Grundrechte sowie die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern in einigen besonders heiklen Materien. Um das Verfassungswerk nicht zu gefährden, wurden schließlich zahlreiche Gesetze aus der Österreichisch-Ungarischen Monarchie übernommen, so insbesondere das Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger vom 21. Dezember 1867, welches bis heute ein Teil der Bundesverfassung ist.
Novelle 1925
In der Ersten Republik erfolgten zwei wesentliche Novellierungen des B-VG. Die Verfassungsnovelle 1925 war Teil einer umfassenden Verfassungs- und Verwaltungsreform, die durch die Verpflichtungen aus den Genfer Protokollen von 1922 notwendig geworden waren. Insbesondere wurde die definitive Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern festgelegt. Die Novelle trat am 1. Oktober 1925 in Kraft.
Novelle 1929
Die Verfassungsnovelle 1929 beinhaltete eine Machtverschiebung vom Parlament zum Bundespräsidenten, der mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet wurde. Auch wurde die direkte Volkswahl des Bundespräsidenten eingeführt.
Das B-VG wurde in der Folge unter dem Titel Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 erneut kundgemacht (BGBl 1930/1).
Austrofaschismus
Am 1. Juli 1934 trat die Bundesverfassung der Ersten Republik außer Kraft und wurde durch die verfassungswidrig erlassene Maiverfassung des Dollfuß-Regimes ersetzt.
Zeit des Nationalsozialismus
Während der Zeit des Nationalsozialismus galt die Verfassung des Deutschen Reiches. Die Weimarer Verfassung war zwar von den Nationalsozialisten formell nicht aufgehoben, jedoch aufgrund des Ermächtigungsgesetzes bereits im Laufe des Jahres 1933 in wesentlichen Punkten materiell außer Kraft gesetzt worden. An die Stelle einer rechtsstaatlichen Verfassung war ein totalitärer Führerstaat getreten, der sich jeder normativen Begrenzung entzog.[1]
Zweite Republik
Nach dem Zusammenbruch des Großdeutschen Reiches 1945 am Ende des Zweiten Weltkriegs und der Wiedererstehung der Republik Österreich konstituierte sich die Provisorische Staatsregierung unter Karl Renner.
Noch vor Ende des Zweiten Weltkrieges auf österreichischem Gebiet wurde am 27. April 1945 von drei Parteien (SPÖ, ÖVP und KPÖ) eine Unabhängigkeitserklärung veröffentlicht. Nach dieser sollte die Republik Österreich im Sinne der Verfassung von 1920 wiederhergestellt werden. Wenige Tage später, am 1. Mai 1945 wurde das Verfassungs-Überleitungsgesetz beschlossen, das das B-VG und weitere Gesetze in der Fassung von vor dem Ständestaat wieder in Kraft setzte. Bis 19. Dezember 1945 (2. V-ÜG BGBl. Nr. 5/1945) war eine Provisorische Verfassung (BGBl. Nr. 5/1945) in Kraft, seit dann wieder die Verfassung von 1920 in der Fassung von 1929.
Seitdem wurde das B-VG knapp hundert Mal novelliert und ist damit wohl die am häufigsten novellierte Verfassung der Welt. Eine Gesamtänderung der Bundesverfassung, welche gemäß Artikel 44 Absatz 3 nur im Wege einer Volksabstimmung erfolgen kann, erfolgte allerdings nur ein einziges Mal, und zwar anlässlich des Beitrittes Österreichs zur Europäischen Union mit der Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle 1994 (BGBl 1994/744). Aus demselben Anlass wurde das B-VG auch wieder in Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) rückbenannt (BGBl 1994/1013).
Baugesetze der Verfassung
Unter den Baugesetzen der Verfassung versteht man die leitenden Grundsätze der Verfassung. In der juristischen Diskussion stehen diese noch eine Rechtsstufe höher als die restlichen Verfassungsbestimmungen. Ihre Definition ist wichtig, um abschätzen zu können, was unter einer „Gesamtänderung der Bundesverfassung“ zu verstehen ist. Für eine Gesamtänderung ist sowohl eine 2/3-Mehrheit im Parlament als auch eine Volksabstimmung verpflichtend (Obligatorische Volksabstimmung).
Die Baugesetze oder Leitenden Prinzipien der Bundesverfassung lauten:
Das demokratische Prinzip
Das demokratische Prinzip betrifft die Frage der Herrschaftsform und der politischen Willensbildung. Die politische Macht in der Gesellschaft wird durch das Volk legitimiert. Dieser Grundsatz ist im Artikel 1 des B-VG verankert: „Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus.“ Besonders wichtig ist hier auch Art. 26 B-VG, er garantiert das allgemeine und geheime Wahlrecht. Österreich ist eine repräsentative Demokratie, deshalb gibt es eine Reihe von Instrumentarien:
- der direkten Demokratie (= Selbstbestimmung durch Wahl), dazu gehören Volksbegehren, Volksbefragung und Volksabstimmung,
- der indirekten Demokratie (= Wahl von Repräsentanten), welche durch die Art. 42–49 B-VG (Nationalrat ist zentrales Organ der Gesetzgebung) und durch Art. 140 B-VG (Verfassungsgerichtshof prüft Gesetze auf ihre demokratische Rechtmäßigkeit) garantiert sind.
Das republikanische Prinzip
Das republikanische Prinzip betrifft die Organisation an der Staatsspitze und die Staatsform (so muss zum Beispiel an der Spitze des Staates ein gewähltes Staatsoberhaupt stehen; im Falle Österreichs ist das der Bundespräsident). Es dient zur Abgrenzung der Republik (zum Beispiel von einer Monarchie). Die Erblichkeit des Amtes des Bundespräsidenten in Österreich verhindert Art. 60 B-VG (Direktwahl des Bundespräsidenten). Das republikanische Prinzip ist in der Verfassung verankert, wo es im Art. 1 B-VG heißt, Österreich ist eine demokratische Republik.
Das bundesstaatliche Prinzip
Das bundesstaatliche Prinzip betrifft den Föderalismus. Österreich ist weder ein Staatenbund noch ein Einheitsstaat. Das Verhältnis der Bundesländer zueinander und zum Bundesstaat wird durch innerstaatliches Recht, nicht durch Völkerrecht geregelt. Dieses Prinzip ist in Artikel 2 Absatz 1 des B-VG verankert: „Österreich ist ein Bundesstaat.“
Jede Materie der Gesetzgebung oder Vollziehung ist in den Artikeln 10-15 B-VG („Kompetenzartikel“) entweder dem Bund oder den Bundesländern zugeordnet. Eine Konkurrierende Gesetzgebung wie in Deutschland ist der österreichischen Verfassungsordnung fremd.
Rechtstechnisch wird vom „dualen System von Enumeration und Generalkompetenz“ gesprochen: alle staatlichen Befugnisse in Gesetzgebung und Vollziehung liegen bei den Bundesländern (Generalkompetenz), nur genau aufgezählte Kompetenzen (Enumeration) in Gesetzgebung und/oder Vollziehung werden vom Bund wahrgenommen. Diese Aufzählung ist freilich so umfangreich, dass in der Praxis nur wenige Materien in der Gesetzgebung den Ländern überlassen werden; der Föderalismusgedanke ist, was die Gesetzgebung betrifft, in Österreich eher schwach ausgeprägt. Wichtig ist hingegen die Funktion der Bundesländer in der Vollziehung der Gesetze.
Zu den bedeutendsten Materien, in denen Gesetzgebung und Vollziehung Landessache sind, gehören unter anderem das Baurecht, die örtliche Sicherheitspolizei, Feuerpolizei, Naturschutz, Sportrecht, Jagd- und Fischereirecht, Veranstaltungsrecht, insbesondere Theater- und Lichtspielwesen, sowie naturgemäß das Dienstrecht der Landes- und Gemeindeangestellten.
In einigen Materien hat der Bund nur die Kompetenz zur Grundsatzgesetzgebung, während die Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung den Bundesländern zukommt; so zum Beispiel im Armenwesen, der Jugendfürsorge oder dem Elektrizitätswesen.
Eine wichtige Gruppe von Kompetenzen schließlich betrifft die Vollziehung von Bundesrecht durch die Länder: Obwohl die Gesetzgebung hier Sache des Bundes ist, erfolgt die Vollziehung unmittelbar durch Landesbehörden, die – anders als im Regelfall der sogenannten „mittelbaren Bundesverwaltung“, wo Landesbehörden funktional als Bundesbehörden agieren, und auch an Weisungen der Bundesorgane (meist Minister) gebunden sind – hier „im eigenen Namen“ agieren. Beispiele hierfür sind das Staatsbürgerschaftsrecht oder die Angelegenheiten der Straßenpolizei.
Das rechtsstaatliche Prinzip
Das rechtsstaatliche Prinzip betrifft die Herrschaft des Rechts, insbesondere das Legalitätsprinzip und das Prinzip der Gewaltentrennung. Das Legalitätsprinzip findet sich in Art. 18 Abs. 1 und 2 B-VG: „Die gesamte staatliche Verwaltung darf nur aufgrund der Gesetze ausgeübt werden.“ Weiters garantiert der „Stufenbau der Rechtsordnung“ durch Erzeugungs- und Prüfverfahren, dass Gesetze rechtmäßig entstanden sind. Diese Gesetze werden nochmals durch den Verfassungsgerichtshof (VfGH) auf ihre Verfassungsmäßigkeit (einschließlich rechtmäßiges Entstehen) überprüft, dies allerdings nur dann, wenn er – etwa in einem Beschwerdeverfahren – seiner Entscheidung ein seiner Auffassung nach verfassungswidriges Gesetz zugrunde legen müsste.
Dieses Ansinnen kann durch den Beschwerdeführer durch Anbringen einer Bescheidbeschwerde (gem Art. 144 Abs. 1 B-VG) erreicht werden. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit einen Individualantrag (gem Art. 140 Abs. 1 4. Satz B-VG) beim Verfassungsgerichtshof einzubringen. Außerdem können Bundesgesetze von einer Landesregierung und Landesgesetze von der Bundesregierung zur Prüfung auf deren Verfassungsmäßigkeit dem VfGH vorgelegt werden (gem Art. 140 Abs. 1 2. Satz B-VG).
Das liberale Prinzip
Das liberale Prinzip besagt, dass dem staatlichen Handeln Grenzen gesetzt sind, um für die Bürger ein gewisses Ausmaß an Freiraum gewährleisten zu können. Dies garantieren die Grundrechtskataloge – dies sind das Staatsgrundgesetz von 1867; die EMRK (Europäische Menschenrechtskonvention) und deren Zusatzprotokolle; das BVG über den Schutz der persönlichen Freiheit; das Gesetz zum Schutze des Hausrechtes; uvm. In ihm sind gewisse „Abwehrrechte“ verankert zum Beispiel Schutz vor willkürlicher Festnahme, Schutz der Meinungsfreiheit, Schutz vor Hausdurchsuchungen, etc.
Das Prinzip der Gewaltentrennung
Das Prinzip der Gewaltentrennung (GT) besteht aus der GT im formellen, organisatorischen und im materiellen Sinn und wurde zur Prävention von Machtkonzentration bei einer der drei Staatsgewalten eingeführt. Im funktionellen Sinn bedeutet die GT, dass es eine Legislative (gesetzgebende Körperschaft), eine Judikative (richtende Körperschaft) und eine Exekutive (verwaltende und ausführende Körperschaft) gibt, denen bestimmte Aufgaben zugewiesen werden. Die GT im organisatorischen Sinn bestimmt, dass es bestimmte Organe innerhalb der einzelnen Körperschaften gibt, die von Personen besetzt werden (so besteht beispielsweise das Organ des Bundespräsidenten, das von einer vom Staatsvolk auf sechs Jahre gewählten Person bekleidet wird). Die GT im materiellen Sinn ist die Zuteilung von bestimmten Aufgaben und Kompetenzen auf bestimmte Organe. (So ernennt der Bundespräsident beispielsweise auf Vorschlag des National- und des Bundesrates die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs [VfGH].) Dennoch bestehen zwischen den im Ideal „getrennten Gewalten“ Verflechtungen durch Ernennungs- und Abberufungsrechte, Mitwirkungsrechte und Kontrollrechte. (Beispielsweise ernennt der Bundespräsident die Richter am VfGH auf Vorschlag der Bundesversammlung (Nationalrat gemeinsam mit Bundesrat) und kann den Nationalrat auf Vorschlag der Bundesregierung auflösen, bedarf aber wiederum der Zustimmung des Nationalrats, um bestimmte Staatsverträge abschließen zu können, muss sich außerdem auch noch dem Bundesvolk verantworten und kann von diesem durch Volksabstimmung abgesetzt werden.). Dieses System der Trennung und Verbindung der Staatsgewalten zugleich wird checks and balances genannt.
Die österreichische Bundesverfassung ist von den Prinzipien der parlamentarischen Demokratie und der Gewaltentrennung geprägt. Das föderalistische Prinzip ist (im Vergleich etwa zu Deutschland oder zur Schweiz) relativ schwach ausgebildet. Die einzelnen Bundesländer verfügen über keine Kompetenzen im Bereich der Judikative. Auch im Bereich der Gesetzgebung hat der Bund ein deutliches Übergewicht. Dem gegenüber wird ein Großteil der staatlichen Verwaltung von den Ländern vollzogen.
Grundrechte
Die Grundrechte der Bundesverfassung sind großteils nicht im B-VG selbst normiert. Da sich die Konstitutierende Nationalversammlung 1920 beim Entwurf des B-VGs nicht auf einen entsprechenden Grundrechtskatalog einigen konnte, übernahm man kurzerhand die Regelungen des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 1867 über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger (StGG) in den Verfassungsbestand.
Dort sind etwa die Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz, die Freizügigkeit der Person und des Vermögens innerhalb des Staatsgebietes, die Vereins-, Versammlungs- und Pressefreiheit, der Schutz des Hausrechts, des Eigentums, des Briefgeheimnisses, Religionsfreiheit, Erwerbsfreiheit und ähnliche liberale Grundrechte normiert. Auch einige andere Gesetze aus der Monarchie wurden übernommen, etwa das Gesetz zum Schutz der persönlichen Freiheit oder das Gesetz zum Schutz des Hausrechtes.
Auch wenn das B-VG keinen Grundrechtskatalog enthält, tragen gewisse Bestimmungen einen „grundrechtsähnlichen Charakter“. Beispiele hierfür sind der Gleichheitgrundssatz in Art. 7 Abs. 1 B-VG, das Recht auf den gesetzlichen Richter in Art. 83 Abs. 2 B-VG oder die Abschaffung der Todesstrafe in Art. 85 B-VG, die heutzutage als Recht auf Leben gelesen wird.
In der Folgezeit kamen weitere Grundrechte hinzu. So sind etwa im Staatsvertrag einschlägige Bestimmungen enthalten. Die Europäische Menschenrechtskonvention trat in Österreich 1958 in Kraft. Sie steht im Verfassungsrang und ist durch Behörden unmittelbar anwendbar. Aus dieser entspringen eine Reihe von Grundrechten, etwa das Recht auf Leben, nulla poena sine lege („Keine Strafe ohne Gesetzesbestimmung“) in Art. 7 EMRK oder das Recht auf ein faires Verfahren in Art. 6 EMRK.
Weitere Grundrechte wurden in der Folgezeit durch Verfassungsgesetze oder Verfassungsbestimmungen in einfachen Gesetze eingeführt. Beispiele hierfür sind etwa das Bundesverfassungsgesetz über den Schutz der persönlichen Freiheit von 1988, das Recht auf Datenschutz im Datenschutzgesetz oder das Recht auf Zivildienst im Zivildienstgesetz.
Kreation von Verfassungsbestimmungen
Verfassungsgesetze können nur mit qualifizierter Mehrheit von zwei Dritteln der Abgeordneten des Nationalrats bei Anwesenheit mindestens der Hälfte der Abgeordneten beschlossen und geändert werden (Art. 44 B-VG). Verlangt ein Drittel der Mitglieder des Nationalrates oder des Bundesrates eine Volksabstimmung über diese Teiländerung, so muss diese vor Beurkundung durch den Bundespräsidenten durchgeführt werden (Art. 44 B-VG).
Gesamtänderung
Tief greifende Änderungen der Verfassung, die die Grundprinzipien maßgeblich berühren, werden als Gesamtänderung der Bundesverfassung bezeichnet. Diese Änderungen müssen zusätzlich zum oben beschriebenen Verfahren durch eine Volksabstimmung bestätigt werden.
Bislang gab es nur eine rechtskonforme „Gesamtänderung“ der Bundesverfassung. Der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union stellte nach herrschender Ansicht eine tief greifende Änderung der Bundesverfassung dar. Es wurde daher ein eigenes Beitrittsverfassungsgesetz beschlossen. Dieses wurde in einer Volksabstimmung von den österreichischen Wahlberechtigten bestätigt und konnte daher in Kraft treten.
Ebenso als (diesmal rechtswidrige) Gesamtänderung der Bundesverfassung beurteilt der österreichische Verfassungsgerichtshof § 126a des Bundesvergabegesetzes in der Fassung von 2001[2], das Teile des Landes-Verfahrensrechts der Überprüfung durch den Verfassungsgerichtshof entzog und somit einen schweren Eingriff in das rechtsstaatliche Prinzip dargestellt habe. Da über diese Gesamtänderung keine Volksabstimmung abgehalten wurde, war sie verfassungswidrig und wurde daher vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben.[3]
Verfassung und Tagespolitik
In Österreich können auch einfache Gesetzesmaterien in den Verfassungsrang gehoben werden. In einem solchen Fall müssen die entsprechenden Paragraphen ausdrücklich als Verfassungsbestimmung bezeichnet sein und mit Zweidrittelmehrheit wie ein Verfassungsgesetz beschlossen werden. Von dieser Möglichkeit wurde in der Zweiten Republik vor allem von der großen Koalition, die meistens die notwendige 2/3-Mehrheit hatte, oft Gebrauch gemacht, vor allem um Gesetze dem Zugriff des Verfassungsgerichtshofs zu entziehen und um für zukünftige Regierungen eine Änderung zu erschweren.
Reform der Verfassung
2003 wurde von der Regierung (Kabinett Schüssel II) der so genannte Verfassungskonvent oder „Österreich-Konvent“ (offizielle Bezeichnung) unter der Leitung des damaligen Rechnungshofpräsidenten Franz Fiedler eingesetzt, der die gültige Verfassung „entrümpeln“ soll. Der Konvent hatte den Auftrag, die Bundesverfassung den neuen Gegebenheiten, die sich im Laufe der Jahrzehnte - vor allem seit dem Beitritt zur EU - ergeben haben, anzupassen und Vorschläge für eine neue Verfassung zu erarbeiten. Er endete am 31. Jänner 2005, ohne formal das gesteckte Ziel erreicht zu haben. Es liegt zwar ein Verfassungsentwurf vor, doch wurde dieser von Franz Fiedler anhand der Ergebnisse der Konventsarbeit verfasst, vom Plenum des Konvents jedoch nicht konsentiert. Vor allem von Seiten der ÖVP wird dieser Entwurf als geeigneter Ausgangspunkt für weitere Bemühungen angesehen, im österreichischen Parlament (wie verfassungsrechtlich vorgesehen) eine neue Verfassung (oder auch nur eine „große Verfassungsnovelle“) zu erarbeiten.
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ Werner Frotscher/Bodo Pieroth, Verfassungsgeschichte, 2. Aufl., München 1999, Rdnr. 634
- ↑ § 126a BVergG i.d.F. BGBl I Nr. 125/2000
- ↑ VfGH G 12/00
Literatur
- Klaus Berchtold: Verfassungsgeschichte der Republik Österreich, Wien 1998. ISBN 3-211-83188-6
- Wilhelm Brauneder: Österreichische Verfassungsgeschichte, 10. Aufl., Wien 2005. ISBN 3-214-14875-3
- Bernd-Christian Funk: Einführung in das österreichische Verfassungsrecht. 13. Aufl., Graz 2007. ISBN 978-3-7011-01047
- Theo Öhlinger: Verfassungsrecht. 7. Aufl., Wien 2007. ISBN 978-3-7089-0152-7
- Christoph Grabenwarter: Offene Staatlichkeit: Österreich. In: Armin von Bogdandy, Pedro Cruz Villalón, Peter M. Huber (Hrsg.): Handbuch Ius Publicum Europaeum (IPE). C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2008, Bd. II, S. 211-241. ISBN 978-3-8114-6301-1
- Ernst C. Hellbling: Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte, 2. Aufl., Wien 1974. ISBN 3-211-81256-3
- Oskar Lehner: Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte. Mit Grundzügen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 4. Aufl., Linz 2007. ISBN 978-3-85487-339-6
- Ewald Wiederin: Grundlagen und Grundzüge staatlichen Verfassungsrechts: Österreich. In: Armin von Bogdandy, Pedro Cruz Villalón, Peter M. Huber (Hrsg.): Handbuch Ius Publicum Europaeum (IPE). C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2007, Bd. I, S. 389-449. ISBN 978-3-8114-3541-4
Weblinks
- Text des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG) (jeweils aktueller Stand) und der wichtigsten Ausführungsvorschriften auf der Website des österreichischen Bundeskanzleramtes
- Bundes-Verfassungsgesetz der Republik Österreich
- Verfassungen Österreichs (1713 bis heute)
- Vorlage:Aeiou
- Webseite des Österreich-Konvents