„Wikipedia Diskussion:Belege“ – Versionsunterschied
| Zeile 275: | Zeile 275: | ||
:::+1 Zum einen schadet es nicht insbesondere solange de.wp keine eigene Liste führt. Zum anderen verwenden viele Autoren auf de.wp auch englischsprachige Belege und dies es eben auch manchmal ohne sich über den "Zuverlässigkeitsstatus" diverser englischsprachigen Medien so im Klaren zu sein, wie das vielleicht bei deutschsprachigen Medien wären.--[[Benutzer:Kmhkmh|Kmhkmh]] ([[Benutzer Diskussion:Kmhkmh|Diskussion]]) 13:57, 31. Aug. 2019 (CEST) |
:::+1 Zum einen schadet es nicht insbesondere solange de.wp keine eigene Liste führt. Zum anderen verwenden viele Autoren auf de.wp auch englischsprachige Belege und dies es eben auch manchmal ohne sich über den "Zuverlässigkeitsstatus" diverser englischsprachigen Medien so im Klaren zu sein, wie das vielleicht bei deutschsprachigen Medien wären.--[[Benutzer:Kmhkmh|Kmhkmh]] ([[Benutzer Diskussion:Kmhkmh|Diskussion]]) 13:57, 31. Aug. 2019 (CEST) |
||
::: Ebenfalls +1: Ich habe die Liste gerade zum ersten Mal angesehen und fand sie ausgesprochen aufschlussreich; viele meiner eigenen Erfahrungen mit amerikanischen Medienangeboten habe ich darin bestätigt gefunden. Und die Fans von RT/Sputnik/Epoch Times bekommen da eine fundierte Entgegnung. Halte ich zumindest ''auch'' für uns nutzbar, solange wir da nichts Eigenes entwickeln. ''Der Spiegel'' steht als deutschsprachiges Medium übrigens auch drin, interessanterweise mit Nennung von Relotius. Gruß, --[[Benutzer:Andropov|Andropov]] ([[Benutzer Diskussion:Andropov|Diskussion]]) 14:02, 31. Aug. 2019 (CEST) |
::: Ebenfalls +1: Ich habe die Liste gerade zum ersten Mal angesehen und fand sie ausgesprochen aufschlussreich; viele meiner eigenen Erfahrungen mit amerikanischen Medienangeboten habe ich darin bestätigt gefunden. Und die Fans von RT/Sputnik/Epoch Times bekommen da eine fundierte Entgegnung. Halte ich zumindest ''auch'' für uns nutzbar, solange wir da nichts Eigenes entwickeln. ''Der Spiegel'' steht als deutschsprachiges Medium übrigens auch drin, interessanterweise mit Nennung von Relotius. Gruß, --[[Benutzer:Andropov|Andropov]] ([[Benutzer Diskussion:Andropov|Diskussion]]) 14:02, 31. Aug. 2019 (CEST) |
||
:::: Die Sache ist sicherlich interessant auch für uns. Allerdings fangen Benutzer und Benutzerinnen wie ich eine bin, mit derartigen englischsprachigen Listen nichts an, da die dafür notwendigen Englischkenntnisse zu rudimentär sind. Diesbezüglich wäre von Vorteil, wenn es davon als deWP-Gegenstück eine deutschsprachige Version geben würde. Und könnte auch, um auch von Wirkung zu sein, bei Einbindung gelisteter Quellen bei der editierenden Artikelarbeit dann auch als Hinweis eingeblendet werden, meint --[[Benutzerin:Elisabeth59|Elisabeth]] 20:51, 31. Aug. 2019 (CEST) |
|||
Version vom 31. August 2019, 20:51 Uhr
Füge neue Diskussionsthemen unten an:
Klicke auf , um ein neues Diskussionsthema zu beginnen.| Archiv |
| Diskussionsarchiv |
| Wie wird ein Archiv angelegt? |
Fehler bei Vorlage * Parametername unbekannt (Vorlage:Archivübersicht): "2"
Ich bräuchte mal Hilfe bezüglich Fachliteratur und "Fach"literatur.
Hallo,
ich bin ein wenig verwirrt und bräuchte mal etwas Hilfe und zwar wird ja in dem Artikel hier erklärt, dass man sich bei Belegen auf die Fachliteratur stützen sollte aber neulich hat jemand erklärt, dass man sich bitte nicht auf "Fach"literatur beziehen soll, also das Fach in Anführungszeichen. [[1]]
Jetzt ist meine Frage, wie kann ich Fachliteratur von "Fach"literatur unterscheiden, damit meine Belege auch anerkennt werden?
Danke--Nina J. Kramer (Diskussion) 13:56, 28. Mai 2019 (CEST)
- Bei dem strittigen Punkt geht es um die deutsche Bezeichnung. Für diese gilt: "Allgemein sollte als Artikeltitel (Lemma) die Bezeichnung verwendet werden, die für den im Artikel behandelten Sachverhalt im deutschen Sprachraum am gebräuchlichsten ist." Da geht es also um den deutschen Sprachraum ganz allgemein, nicht zwingend die Verwendung in der Fachliteratur. Alle inhaltlichen Fragen sollten sich dennoch auf Fachliteratur stützen, sofern diese vorliegt. Dabei ist dann ggf. der Begriff anzupassen. In wissenschaftlichen Texten besteht das Problem ständig bei der Verwendung von Trivialnamen. Es gibt dafür keine eindeutige, regelbasierte Lösung, aber der Sprachgebrauch im Artikel sollte nachvollziehbar und möglichst einheitlich sein.--Meloe (Diskussion) 15:13, 28. Mai 2019 (CEST)
- Ok, also nehmen wir mal an ich habe hier 10 Fachbücher zum Thema X und diese 10 Fachbücher (3 deutsch / 7 englisch) sind sich über die Benennung einig. Es existiert aber ein Buch welches eine Mischform der Benennung verwendet, das Problem bei diesem Buch ist jedoch, dass faktische Fehler enthält und gar nicht ausschließlich von Thema X handelt. Welcher Benennung sollte man dann folgen? --Nina J. Kramer (Diskussion) 15:29, 28. Mai 2019 (CEST)
- Kläre das im Detail bitte auf der Artikeldiskussion, dafür ist hier der falsche Ort.--Meloe (Diskussion) 15:40, 28. Mai 2019 (CEST)
- Funktioniert leider nicht, der Verfechter von dem einen Buch und 10 Jahre alten fachfremden Spiegelartikeln lässt nicht mit sich reden und benutzt seine automatische Sichermacht um alle Änderungen zu blocken. Schade eigentlich für die Wikipedia. --Nina J. Kramer (Diskussion) 15:48, 28. Mai 2019 (CEST)
- Wenn die Diskussion festgefahren ist, gibt es die Möglichkeit unter Wikipedia:Dritte Meinung eine Dritte Meinung anzufordern. Geht es ausschließlich um die Quialität eines Belegs, ist eine Anfrage auf Wikipedia:Belege/Fließband eine Möglichkeit. Das lässt sich aber letztlich nur konkret lösen, nicht allgemein.--Meloe (Diskussion) 15:55, 28. Mai 2019 (CEST)
Telepolis entfernt
Heute wurde in meinem Artikel Starostové a nezávislí ein Beleg mit dem Kommentar "Heise ist keine Quelle" entfernt. Es sollte den unverfänglichen Satz belegen "Heise vergleicht sie mit den Freien Wählern". Das war von mir vielleicht unglücklich formuliert, wenn man (bei einer Belegentfernung würde ich es voruassetzen) reinschaut, stellt man fest, dass es sich um den Aufsatz "Tschechien: Anti-Establishment-Partei gewinnt Regionalwahlen" von Peter Mühlbauer in der Onlinezeitschrift Telepolis handelt, die u.a. mit dem "Europäischen Preis für Online-Journalismus 2000" und "Grimme Online Award 2002" ausgezeichnet wurde. Telepolis gehört nun mal irgendwie zu Heise Zeitschriftenverlag. Bitte um Klärung. -jkb- 16:22, 28. Mai 2019 (CEST)
- Nicht gerechtfertigt. Eine elektronische Zeitschrift wie Telepolis ist genauso eine Zeitschrift wie eine auf Papier gedruckte. Es geht also dann nach der Reputation der Zeitschrift selbst, die ist hier klar gegeben (übrigens verwendet die umseitige Funktionsseite selbst einen Telepolis-Artikel). Dass die Zeitschrift bei Heise Medien (vormals Heise Zeitschriften Verlag) erscheint, ist dabei schlicht egal. Ich nehme an, es war schlicht eine Verwechslung mit Heise online.--Meloe (Diskussion) 17:15, 28. Mai 2019 (CEST)
- Telepolis ist grenzwertig und im Zweifel ungeeignet, bietet auch fragwürdigen Journalisten mit Berührung zum VT-Milieu ein Forum. So sehen “wir“ das bisher. Wenn es um bestimmte “neutrale Informationen“ geht, muss man im Einzelfall entscheiden --JosFritz (Diskussion) 17:44, 28. Mai 2019 (CEST)
- Dieser Einschätzung stimme ich zu. Im Gegensatz zu den Produkten von Heise die sich mit technischen Dingen beschäftigen, die ich als seriös und fundiert ansehen würde (egal ob Print oder Online), ist Telepolis eher in die Ecke Boulevard und VT einzuordnen. Finanzer (Diskussion) 17:49, 28. Mai 2019 (CEST)
- Der umstrittene Artikel Tschechien: Anti-Establishment-Partei gewinnt Regionalwahlen besitzt jedenfalls nur geringes verschwörungstheoretisches Potenzial. Er hätte dann wohl auch die Einzelfallprüfung bestanden.--Meloe (Diskussion) 18:29, 28. Mai 2019 (CEST)
- Dieser Einschätzung stimme ich zu. Im Gegensatz zu den Produkten von Heise die sich mit technischen Dingen beschäftigen, die ich als seriös und fundiert ansehen würde (egal ob Print oder Online), ist Telepolis eher in die Ecke Boulevard und VT einzuordnen. Finanzer (Diskussion) 17:49, 28. Mai 2019 (CEST)
- Telepolis hat als seit 1996 (!) erscheinendes Onlinemagazin eine lange Geschichte und hatte im Laufe der Jahre ein breites Spektrum von Autoren. Unter anderem erschienen bei Telepolis zu seinen Lebzeiten auch Artikel von Stanisław Lem. Man kann dieses Magazin sicher weder in Bausch und Bogen verdammen noch unbesehen als Quelle verwerden. Gestumblindi 13:47, 30. Mai 2019 (CEST)
3M:
- Ich neige eher zu Skepsis gegenüber diesen Organen. Mainstreammedien sind sie ja nicht gerade, und in Presseschauen oder anderen Teilen der Qualitätspresse werden sie nicht rezipiert. Daher kann, was telepolis so schreibt, kaum als gut gesichertes, etabliertes Wissen gelten, und das ist es doch, was wir nach WP:Q abbilden wollen. Warum sollten wir uns also darauf stützen? Im Einzelfall mag das ausnahmsweise anders aussehen, aber der wäre dann eigens begründungspflichtig. --Φ (Diskussion) 18:58, 28. Mai 2019 (CEST)
- So pauschal stimmt das nicht:
- Die bpb führt Telepolis neben vielen anderen Medien in der Sicherheitspolitischen Presseschau: [2]
- Beim Perlentaucher ist TP auch regelmäßig vertreten: [3] (war auch schon so, als der Perlentaucher noch bei SPON erschien)
- Bei der Zeit wird TP auch hier und da genannt: [4] [5] [6] (nicht im VT-Kontext wohlgemerkt)
- Nebenbei bemerkt fand Peter Sloterdijk das Magazin vor fünf Jahren offenbar sympathisch: [7]
- Vielleicht sollten wir festhalten, dass es immer eine Einzelfallbetrachtung ist. Selbst der Qualitätspressen-SPIEGEL ist davon nicht ausgenommen. Wir reden hier in beiden Fällen von journalistischen, nichtswissenschaftlichen Quellen. Eine pauschale Ablehnung "weil von Heise" oder "weil in Telepolis" ist jedenfalls durch keine Regel gedeckt. --Gamba (Diskussion) 20:53, 28. Mai 2019 (CEST)
- Du schreibst zwar "Heise", meinst aber "Telepolis". Die sind aber eben nicht "irgendwie Heise", denn die Kompetenz im Computer- und Medienbereich von "Heise" lässt sich nicht auf den Polit-Blog Telepolis übertragen. Wenn der Autor relevant oder renommiert genug ist, kannst du es über seinen Namen laufen lassen, Telepolis nur im Einzelnachweis benutzen, und schreiben: "Peter Mühlbauer schrieb..." das wäre m.M.n. ok, dann bürgt der Name für den Inhalt. Alexpl (Diskussion) 19:13, 28. Mai 2019 (CEST)
- Nein, der Name allein bürgt bei uns nicht für den Inhalt, sonst wäre jedes Blog einer relevanten Person ebenfalls relevant. --JosFritz (Diskussion) 19:28, 28. Mai 2019 (CEST)
- 3M: einer Meinung nach liegt Alexpl hier völlig richtig: Warum sollte man z.B. aus dem (zurzeit vielfach rezipierten) Blog von Armin Wolf nicht dessen Aussagen/Kommentare zitieren? Nur, weil Blogs zumeist keine zuverlässigen Quellen sind, heißt das im Umkehrschluss eben nicht, dass nur unzuverlässige Leute auf Blogs schreiben. Es gibt ja viele Gründe (auch für zuverlässige Schreiber), den Weg über Blogs zu gehen. Ist die schreibende Person ein(e) renommierte WissenschaftlerIn, JournalistIN o.ä. kann sie m.E. sehr wohl zitiert werden. VG --Wisdom cough (Diskussion) 19:52, 28. Mai 2019 (CEST)
- Es kommt eben darauf an. Armin Wolfs Blog ist sicher seriös und in der Regel als Beleg geeignet, wenn er nicht in eigener Sache blogt. Andere Blogs, etwa eines von Strache, wären dagegen in aller Regel als Beleg ungeeignet. --JosFritz (Diskussion) 19:57, 28. Mai 2019 (CEST)
- Also doch wegen des "Namens allein", nicht zu gebrauchen. Alexpl (Diskussion) 20:07, 28. Mai 2019 (CEST)
- Telepolis ist kein richtiger Blog Wisdom cough - bedaure wenn das falsch rüberkam. Alexpl (Diskussion) 20:07, 28. Mai 2019 (CEST)
- Ja, was Telepolis genau ist, frage ich mich schon länger. Aber die Frage der Blogs war nun mittlerweile schon eine etwas allgemeinere - so ist auch mein Einwurf zu verstehen. VG --Wisdom cough (Diskussion) 20:10, 28. Mai 2019 (CEST)
- Es kommt eben darauf an. Armin Wolfs Blog ist sicher seriös und in der Regel als Beleg geeignet, wenn er nicht in eigener Sache blogt. Andere Blogs, etwa eines von Strache, wären dagegen in aller Regel als Beleg ungeeignet. --JosFritz (Diskussion) 19:57, 28. Mai 2019 (CEST)
- 3M: einer Meinung nach liegt Alexpl hier völlig richtig: Warum sollte man z.B. aus dem (zurzeit vielfach rezipierten) Blog von Armin Wolf nicht dessen Aussagen/Kommentare zitieren? Nur, weil Blogs zumeist keine zuverlässigen Quellen sind, heißt das im Umkehrschluss eben nicht, dass nur unzuverlässige Leute auf Blogs schreiben. Es gibt ja viele Gründe (auch für zuverlässige Schreiber), den Weg über Blogs zu gehen. Ist die schreibende Person ein(e) renommierte WissenschaftlerIn, JournalistIN o.ä. kann sie m.E. sehr wohl zitiert werden. VG --Wisdom cough (Diskussion) 19:52, 28. Mai 2019 (CEST)
- Telepolis ist ein Onlinemagazin, das früher mal ein Printmagazin war. Definitiv kein Blog, weder ein richtiger noch ein falscher. Warum fragt ihr euch, statt in den Artikel Telepolis zu schauen? --Gamba (Diskussion) 20:39, 28. Mai 2019 (CEST)
- Ja, tut mir leid, habe mich missverständlich ausgedrückt: mit "was T. genau ist" meinte ich eigtl., dass das "Magazin" (das ja dennoch sehr "blogartig" daherkommt) eben einen etwas zweifelhaften Status genießt (s. gesamte Diskussion bisher) und ich auch selbst nicht genau einschätzen kann, wie oder ob ich mich zu T. positionieren kann; denn ich finde, die Beiträge differieren nicht nur sehr stark in der handwerklichen Qualität, sondern auch in grundsätzlich politischer Hinsicht. Nochmals VG --Wisdom cough (Diskussion) 00:30, 29. Mai 2019 (CEST)
- Der Einschätzung hinsichtlich Qualität und Inhalten kann ich mich anschließen. Der blogartige Eindruck entsteht bei dir vielleicht dadurch, dass es nicht neben der Drei-Leute-Redaktion und den "ständigen" Mitarbeitern (das sind nach meinem Verständnis freie, die regelmäßig für TP schreiben) ein Bloggerteam gibt (s. Impressum)? --Gamba (Diskussion) 12:35, 29. Mai 2019 (CEST)
- Vielen Dank für die Info, Gamba - wusste ich noch nicht. Viele Grüße --Wisdom cough (Diskussion) 20:46, 29. Mai 2019 (CEST)
Danke für die Beteiligung! Für mich ergibt sich: hier vorsichtig, jedoch im vorliegenden Fall offenbar unproblematisch: es handelt sich um eine unproblematische Information, die a) nachvollziehbar ist und b) keine Konsequenzen hat; die tschechische Partei, in DE weitgehend unbekannt, wird verglichen mit freien Wählern (ergibt schon der Text des Artikels) und hilft somit die Partei einzuordnen, nichts mehr. Danke, -jkb- 01:41, 30. Mai 2019 (CEST)
- Das ist aber eine gewagte Aussage: Eine Partei einordnen ist eine "unproblematische Information"?
- Telepolis ist für mich grundsätzlich kein seriöser Journalimus. Das sind meist Meinungsäusserungen. Für Tatsachen gibt es sicher andere Quellen. --Pauelz (Diskussion) 14:22, 31. Mai 2019 (CEST)
- Die Einordnung einer Partei im politischen Spektrum ist doch eine Meinung, keine Tatsachenfeststellung.--Meloe (Diskussion) 15:21, 31. Mai 2019 (CEST)
- Das ist wohl nicht dein Ernst, aber ich versuch mir mal vorzustellen, wie du mit dieser Einstellung oder Meinung wählen gehst. Im Artikel ist das Schlimmste behoben; Telepolis gehört ganz nie in eine Artikeleinleitung.--Pauelz (Diskussion) 15:55, 4. Jun. 2019 (CEST)
- Die Einordnung einer Partei im politischen Spektrum ist doch eine Meinung, keine Tatsachenfeststellung.--Meloe (Diskussion) 15:21, 31. Mai 2019 (CEST)
YouTube als Beleg
Guten Abend, ich weiß nicht, ob es bereits diskutiert wurde und ich in den letzten Jahren etwas übersehen habe, aber nachdem jemand mir äußerst freundlich mitgeteilt hat, es sei „gelinde gesagt Unsinn“ , YouTube per se als geeignete Quelle anzuzweifeln, möchte ich gern wissen, wie dies eingeschätzt und bewertet wird. Es geht mir nicht um irgendein fatales Video – etwa Die Zerstörung der CDU o.ä., bei dem ich verstehe, dass es verlinkt wird – oder videoaffine Bereiche, sondern um die grundsätzliche Frage, wie dies (auch gemessen an WP:NPOV, WP:WWNI, WP:TF etc.) betrachtet wird. Kommt es etwa stets auf den Kontext an, so dass man unterscheiden muss, was „belegt“ wird oder werden soll, ist es von den jeweiligen Gegenständen und Themen abhängig oder ...? Gruß --Gustav (Diskussion) 23:23, 28. Mai 2019 (CEST)
- Ja, es wurde bereits diskutiert. Nur soviel: Youtube ist ein Medium, eine Stelle, wo man bestimmte (taugliche oder untaugliche) Quellen einsehen kann, genau wie "Zeitungskiosk", "Bibliothek", "Internet". Youtube ist keine Quelle, weder eine taugliche noch eine nicht taugliche. Wenn man etwas, was vielleicht aus einer tauglichen Quelle stammt, mit "Youtube" referenziert, taugt die Quellenangabe nichts, über die Quelle sagt das nichts aus. Insofern müsstest Du Deine Frage präziser formulieren, worum es genau geht.
Nur soviel: ja, auf den Kontext kommt es dabei auch an.--Global Fish (Diskussion) 23:50, 28. Mai 2019 (CEST)- Konkret (und paradigmatisch) geht es um diesen Zusatz, mit dem ein Tagesschau-Video über YouTube verlinkt wurde, das sich bereits vorher, wenn auch kürzer, über den tagesschau.de-Nachweis ([8]) aufrufen lässt. Es ging mir aber um eine Grundsatzfrage, etwa ob bestimmte Aussagen der im Artikel dargestellten Person bzw. Bewertungen und Einschätzungen von Kritikern durch jeweils herausgefischte Videos ggf. mit Zeitangabe und -Verlinkung (t=Xs) belegt werden können oder sollten. --Gustav (Diskussion) 13:58, 29. Mai 2019 (CEST)
- Der Link auf YouTube dient zur Einfügung einer Primärquelle. Wenn Sekundärquellen wie dort vorhanden sind, sollten Primärquellen wegen WP:Q und WP:TF entfernt werden. --Ghilt (Diskussion) 15:42, 29. Mai 2019 (CEST)
- In Gustavs Beispiel ist die Quelle die Tagesschau vom soundsovielten. (Als journalistische Quelle bedingt tauglich). Der Youtube-Link ist keine Quelle, sondern lieferte nur eine (hilfreiche) Zusatzinformation für den Leser (genau wie ein Link zu einem auch online erschienen Printartikel). --Global Fish (Diskussion) 15:51, 29. Mai 2019 (CEST)
- Relevante Primärquellen können im Einzelfall durchaus zusätzlich zu Sekundärquellen bzw. Sekundärliteratur angegeben werden. Das steht nicht im Widerspruch zu WP:Q oder WP:TF sondern ist ein nützlicher Leserservice.--Kmhkmh (Diskussion) 18:04, 29. Mai 2019 (CEST)
- Der Link führt auf das Videozitat und somit auf die Primärquelle, und nicht auf den nachfolgenden Kommentar (die Sekundärquelle). --Ghilt (Diskussion) 14:38, 30. Mai 2019 (CEST)
- Der Link auf YouTube dient zur Einfügung einer Primärquelle. Wenn Sekundärquellen wie dort vorhanden sind, sollten Primärquellen wegen WP:Q und WP:TF entfernt werden. --Ghilt (Diskussion) 15:42, 29. Mai 2019 (CEST)
- Konkret (und paradigmatisch) geht es um diesen Zusatz, mit dem ein Tagesschau-Video über YouTube verlinkt wurde, das sich bereits vorher, wenn auch kürzer, über den tagesschau.de-Nachweis ([8]) aufrufen lässt. Es ging mir aber um eine Grundsatzfrage, etwa ob bestimmte Aussagen der im Artikel dargestellten Person bzw. Bewertungen und Einschätzungen von Kritikern durch jeweils herausgefischte Videos ggf. mit Zeitangabe und -Verlinkung (t=Xs) belegt werden können oder sollten. --Gustav (Diskussion) 13:58, 29. Mai 2019 (CEST)
Ein Problem von Youtube und Videos allgemein ist die Langzeitarchivierung. Wird das Video gelöscht, haben wir keine Archiv-Version davon und können die Fakten nicht mehr nachvollziehen oder überprüfen. Teils Sendungen, wie Frontal21, laden Manuskripte der Sendungen ins Netz, was sehr hilfreich ist.[9]. --KurtR (Diskussion) 02:25, 30. Mai 2019 (CEST)
- Ist ja alles richtig, kann bei Internetseiten generell passieren (und nein, nicht von allen gibt es ein Archiv). Das ist aber nicht das Thema dieser Seite: hier gilt es zu wissen: Die Quelle heißt niemals Youtube. Die heißt "die und die Fernsehsendung" oder "der und der künstlerischer Auftritt" etc. (Ich halte Fernsehsendungen wegen tendenzieller höherer Flüchtigkeit und weil man nur gesprochene Worte hat, für tendenziell schlechter als Printartikel, aber das sehen manche anders).--Global Fish (Diskussion) 08:09, 30. Mai 2019 (CEST)
- Die Frage kommt seit Jahren immer wieder und man kann eigentlich nie etwas anderes dazu sagen, als es Global Fish hier auch bereits wieder getan hat und ich nun in anderen Worten wiederholen möchte ;-) : Youtube ist eine Plattform, auf der Personen oder Organisationen ihre eigenen oder fremde Videos hochladen können. Das tun sie oft mit Genehmigung und legal, manchmal sind Youtube-Videos auch Urheberrechtsverstösse. Auch auf anderen Plattformen, Youtube ist bloss die bekannteste - aber es gibt ja auch z.B. noch Vimeo oder die eigenen Websites der Produzenten von Inhalten. Ob ein solches Video (bzw. beispielsweise eine Fernsehsendung als Video) nun als Beleg geeignet ist, hängt von diesem Video, seinem Inhalt und Zusammenhang ab, nicht von der Plattform. Gestumblindi 13:37, 30. Mai 2019 (CEST)
- Ich kann mich vage an Chopin-Artikel erinnern, die mit YouTube „belegt“ waren. Letztlich geht es mir weniger um originelle Theoriefindung, die inhaltlich gar nicht „falsch“ sein muss – so könnte ich etwa mit diesem Link ([10]) belegen, dass Martha Argerich eine großartige und fesselnde Oktav-Spielerin ist, mit jenem [11] dass Eugen Drewermann, was auch immer man heute von ihm halten mag, ein charismatischer Redner mit phantastischem Gedächtnis und Sprachverständnis ist etc. pp. –, sondern um „kritische“ Einschätzungen, um Rezeptionsfragen, die mit Filmen untermauert werden, in denen A oder B sich über C äußern, wenn sich diese Äußerungen nicht in anderen Medien finden. --Gustav (Diskussion) 15:05, 30. Mai 2019 (CEST)
- Nun, man kann mit einem Video aus dem Netz, wenn man keinen besseren Beleg hat, schon belegen, dass jemand etwas Bestimmtes gesagt hat. Mit [12] kann man zwar nicht belegen, dass Drewermann ein charismatischer Redner ist (weil das die Interpretation des Rezipienten dieses Videos ist), aber z.B., dass er in diesem Vortrag "Die Macht des Geldes gründet sich darin, dass sie einem Menschen verspricht, etwas zu sein, was er nicht ist" gesagt hat. Natürlich kann man ein Video auch fälschen, aber das trifft ebenfalls für alle Texte und Bilder im Internet zu. Wenn es dir aber darum geht, ob es angemessen ist, eine Äusserung von A über B wiederzugeben, wenn sich diese nur in einem einzelnen Video findet, dann müsste man diese Frage verallgemeinern - sie könnte dann gleichermassen für jede Quelle, jedes Medium gelten (auch z.B. ein gedrucktes Interview, das sonst nirgends aufgegriffen wurde). Gestumblindi 15:41, 30. Mai 2019 (CEST)
- Man kann mit Youtube vielleicht belegen, dass irgendjemand irgendwann mal irgendetwas gesagt hat, OK, aber man kann nicht belegen, dass diese Angabe enzyklopädisch irgendwie relevant wäre. Wikipedia-Artikel sollen gut gesichertes, etabliertes Wissen enthalten, mit dem Ziel, den aktuellen Kenntnisstand darzustellen. Wir schreiben doch bitte nicht alles, was der Fall ist undsich irgendwie belegen lässt, in unsere Artikel hinein.
- Von den allfälligen URV-Problemen bei Youtube-Filmen mal ganz abgesehen. --Φ (Diskussion) 16:13, 30. Mai 2019 (CEST)
- Ich sehe dies ähnlich, habe aber das Gefühl und sehe es auch in dieser Diskussion, dass YouTube für kalte Fakten mittlerweile akzeptiert und zunehmend genutzt wird. Diese müssen dann in der Tat einer Relevanzprüfung unterzogen werden mit der zusätzlichen Frage, ob sich nicht andere zuverlässige Belege (WP:Q) finden lassen. Mit den Wertungen „charismatisch“ oder „fesselnd“ (ohne Anführungszeichen beim Wort „belegen“) wollte ich die Problematik der Videos etwa im Bereich Kritik oder Rezeption verdeutlichen. Wer ernste Musik und Pianisten einschätzen kann, wird hören und erkennen, wie Horowitz, Michelangeli, Argerich oder Volodos spielen, was sie als Künstler auszeichnet etc., braucht dafür natürlich Belege, die er meist finden wird. Wenn ein renommierter Kritiker (A) etwas über einen Künstler (B) schreibt, kann dies in angemessenem Rahmen darstellt werden, selbst wenn es sich nur in einem Buch findet. Dass Drewermann, ohne etwas abzulesen, Stunden fehlerfrei und hochgradig elaboriert spricht und die Zuhörer dabei in andächtiges Schweigen sinken und gelegentlich schlucken müssen, habe ich selbst mehrfach erlebt; auch hier ließen sich vermutlich Belege finden.--Gustav (Diskussion) 16:32, 30. Mai 2019 (CEST)
- Nachtrag: Hier etwa [13] soll u.a. mit YouTube „belegt“ werden, dass es bereits jetzt, wenige Tage nach der Wahl, den Begriff „Rezo-Effekt“ gibt, der den „teils drastischen Rückgang von Stimmen für die großen Deutschen Parteien bei der Europawahl 2019“ bezeichnet (sic!). --Gustav (Diskussion) 17:17, 30. Mai 2019 (CEST)
- Wenn in diesen Video ein anerkannter Experte über den Rezo-Effekt referieren würde und diesen auch so nennt, dann wäre das gegebenenfalls schon als Beleg zulässig. Allerdings reicht das im gegebenen Kontext nicht, um die Etablierung des Begriffes nachzuweisen.--Kmhkmh (Diskussion) 17:32, 30. Mai 2019 (CEST)
- Nachtrag: Hier etwa [13] soll u.a. mit YouTube „belegt“ werden, dass es bereits jetzt, wenige Tage nach der Wahl, den Begriff „Rezo-Effekt“ gibt, der den „teils drastischen Rückgang von Stimmen für die großen Deutschen Parteien bei der Europawahl 2019“ bezeichnet (sic!). --Gustav (Diskussion) 17:17, 30. Mai 2019 (CEST)
- All das das hat mit der der allgemeinen Youtube-Frage nichts zu tun. Youtube ist wie oben mehrfach erwähnt ein Medium wie eine Webseite oder Buch. Ob ein Youtube-Video als Beleg verwendbar ist oder nicht (und zwar sowohl für "kalte Fakten" als auch "Bewertungen") hängt von Autor, Verlag, Legalität (und gegebenenfalls seinen Reviews) ab. Wenn ein bekannter Musikkritiker in einer renommierten Sendung auftritt und davon eine legale Kopie auf Youtube vorliegt, kann man natürlich verwenden um eine Bewertung von Argerich's Klavierspiel zu belegen. Ähnlich wie man ein entsprechen Artikel oder ein Buch eines Musikkritikers verwenden würde. Natürlich kann man nicht beliebige Youtube-Videos verwenden bzw. persönlich interpretieren, genauso wenig wie man mit Buch oder Journalpublikationen darf.--Kmhkmh (Diskussion) 17:21, 30. Mai 2019 (CEST)
- Ich sehe dies ähnlich, habe aber das Gefühl und sehe es auch in dieser Diskussion, dass YouTube für kalte Fakten mittlerweile akzeptiert und zunehmend genutzt wird. Diese müssen dann in der Tat einer Relevanzprüfung unterzogen werden mit der zusätzlichen Frage, ob sich nicht andere zuverlässige Belege (WP:Q) finden lassen. Mit den Wertungen „charismatisch“ oder „fesselnd“ (ohne Anführungszeichen beim Wort „belegen“) wollte ich die Problematik der Videos etwa im Bereich Kritik oder Rezeption verdeutlichen. Wer ernste Musik und Pianisten einschätzen kann, wird hören und erkennen, wie Horowitz, Michelangeli, Argerich oder Volodos spielen, was sie als Künstler auszeichnet etc., braucht dafür natürlich Belege, die er meist finden wird. Wenn ein renommierter Kritiker (A) etwas über einen Künstler (B) schreibt, kann dies in angemessenem Rahmen darstellt werden, selbst wenn es sich nur in einem Buch findet. Dass Drewermann, ohne etwas abzulesen, Stunden fehlerfrei und hochgradig elaboriert spricht und die Zuhörer dabei in andächtiges Schweigen sinken und gelegentlich schlucken müssen, habe ich selbst mehrfach erlebt; auch hier ließen sich vermutlich Belege finden.--Gustav (Diskussion) 16:32, 30. Mai 2019 (CEST)
- Nun, man kann mit einem Video aus dem Netz, wenn man keinen besseren Beleg hat, schon belegen, dass jemand etwas Bestimmtes gesagt hat. Mit [12] kann man zwar nicht belegen, dass Drewermann ein charismatischer Redner ist (weil das die Interpretation des Rezipienten dieses Videos ist), aber z.B., dass er in diesem Vortrag "Die Macht des Geldes gründet sich darin, dass sie einem Menschen verspricht, etwas zu sein, was er nicht ist" gesagt hat. Natürlich kann man ein Video auch fälschen, aber das trifft ebenfalls für alle Texte und Bilder im Internet zu. Wenn es dir aber darum geht, ob es angemessen ist, eine Äusserung von A über B wiederzugeben, wenn sich diese nur in einem einzelnen Video findet, dann müsste man diese Frage verallgemeinern - sie könnte dann gleichermassen für jede Quelle, jedes Medium gelten (auch z.B. ein gedrucktes Interview, das sonst nirgends aufgegriffen wurde). Gestumblindi 15:41, 30. Mai 2019 (CEST)
- Ich kann mich vage an Chopin-Artikel erinnern, die mit YouTube „belegt“ waren. Letztlich geht es mir weniger um originelle Theoriefindung, die inhaltlich gar nicht „falsch“ sein muss – so könnte ich etwa mit diesem Link ([10]) belegen, dass Martha Argerich eine großartige und fesselnde Oktav-Spielerin ist, mit jenem [11] dass Eugen Drewermann, was auch immer man heute von ihm halten mag, ein charismatischer Redner mit phantastischem Gedächtnis und Sprachverständnis ist etc. pp. –, sondern um „kritische“ Einschätzungen, um Rezeptionsfragen, die mit Filmen untermauert werden, in denen A oder B sich über C äußern, wenn sich diese Äußerungen nicht in anderen Medien finden. --Gustav (Diskussion) 15:05, 30. Mai 2019 (CEST)
- Die Frage kommt seit Jahren immer wieder und man kann eigentlich nie etwas anderes dazu sagen, als es Global Fish hier auch bereits wieder getan hat und ich nun in anderen Worten wiederholen möchte ;-) : Youtube ist eine Plattform, auf der Personen oder Organisationen ihre eigenen oder fremde Videos hochladen können. Das tun sie oft mit Genehmigung und legal, manchmal sind Youtube-Videos auch Urheberrechtsverstösse. Auch auf anderen Plattformen, Youtube ist bloss die bekannteste - aber es gibt ja auch z.B. noch Vimeo oder die eigenen Websites der Produzenten von Inhalten. Ob ein solches Video (bzw. beispielsweise eine Fernsehsendung als Video) nun als Beleg geeignet ist, hängt von diesem Video, seinem Inhalt und Zusammenhang ab, nicht von der Plattform. Gestumblindi 13:37, 30. Mai 2019 (CEST)
techn. Frage zur Darstellung komplexer URLs
Kennt jemand einen Trick, um MediaWiki dazu zu bringen, auch eine "komplexe" URL sauber als Link darzustellen? Konkret geht es um den Einzelbeleg Nr. 16 im Artikel Georg Peters (Mediziner). Die komplexe URL lautet: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cologne[Affiliation]+OR+Koln[Affiliation]+OR+Muenster[Affiliation]+OR+Munster[Affiliation]+AND+Peters+G[author]+NOT+29285635[PMID]+NOT+26799652[PMID]+NOT+9797704[PMID]
Bei konventioneller Einzelbeleg-Formattierung[1] kommt Schrott (s.u.) heraus. --Túrelio (Diskussion) 11:26, 29. Mai 2019 (CEST)
- Hilfe:Links#Sonderzeichen_in_URL,_Linktext_und_Bildlegende. Ich hab's mal repariert; hoffe, es passt so. --DaizY (Diskussion) 11:34, 29. Mai 2019 (CEST)
- Super. Herzlichen Dank. --Túrelio (Diskussion) 11:39, 29. Mai 2019 (CEST)
- ↑ [Affiliation+OR+Koln[Affiliation]+OR+Muenster[Affiliation]+OR+Munster[Affiliation]+AND+Peters+G[author]+NOT+29285635[PMID]+NOT+26799652[PMID]+NOT+9797704[PMID] PubMed Suchergebnis], Stand 25. Mai 2019
Umfrage Technische Wünsche: Themenschwerpunkt „Fehler bei der Arbeit mit Belegen reduzieren“
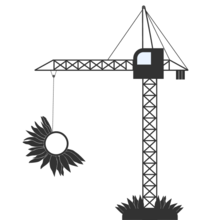
→ häufige Fragen zur Umfrage
Bis zum 30. Juni findet in der deutschsprachigen Wikipedia die vierte Umfrage Technische Wünsche statt. In diesem Jahr wird erstmals darüber abgestimmt, in welchem Themenschwerpunkt das Technische-Wünsche-Team für Verbesserungen sorgen soll. Es stehen 13 Schwerpunkte aus ganz unterschiedlichen Bereichen zur Wahl. Für die hier Mitlesenden könnte von Interesse sein, dass „Fehler bei der Arbeit mit Belegen reduzieren“ einer der Themenschwerpunkte ist, für die abgestimmt werden kann.
Nach der Umfrage wird sich das Team Technische Wünsche mit dem Gewinnerschwerpunkt auseinandersetzen und in enger Zusammenarbeit mit der deutschsprachigen Community verschiedene Probleme darin angehen. Welche Probleme das sind, wird gemeinsam mit den Aktiven in den Wiki-Projekten nach der Umfrage ermittelt.
Also: Gerne abstimmen und weitersagen! Hier gehts zur Umfrage.
Feedback ist wie immer willkommen. Die zentrale Stelle dafür ist die Diskussionsseite der Umfrage. -- Johanna Strodt (WMDE) (Diskussion) 11:21, 17. Jun. 2019 (CEST)
PS: Wer direkt über Neuerungen aus dem Projekt informiert werden möchte, kann sich auf dem Newsletter Technische Wünsche eintragen. Mehr Infos zum Projekt Technische Wünsche gibt es hier.
Rechtsquellen mit {{Literatur}} zitieren
Ich habe gerade in Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933 mit wie folgt zitiert:
§ 98 Geschäftsordnung für den Reichstag. In: Büro des Reichstags (Hrsg.): Reichstags-Handbuch VIII. Wahlperiode. Druck und Verlag der Reichsdruckerei, Berlin 1933, S. 32 (Volltext bei der Bayerischen Staatsbibliothek [abgerufen am 1. Juli 2019]).
{{Literatur
|Titel=§ 98 Geschäftsordnung für den Reichstag
|Sammelwerk=Reichstags-Handbuch VIII. Wahlperiode
|Datum=1933
|Ort=Berlin
|Verlag=Druck und Verlag der Reichsdruckerei
|Hrsg=Büro des Reichstags
|Online=Volltext bei der Bayerischen Staatsbibliothek
|Zugriff=2019-07-01
|Seiten=32
}}
- Spricht da grundsätzlich was gegen? Bei so alten Rechtsquellen halte ich zumindest den Link und das Zugriffsdatum für sinnvoll.
- Sehe ich das richtig, dass der "Titel" eigentlich nicht kursiv sein sollte? --Universalamateur (Diskussion) 20:31, 1. Jul. 2019 (CEST)
- Derart fachspezifische Dinge im Bezug auf Belege sind eigentlich eher eine Frage für die zuständigen Fachredakationen/Fachportalen und bzw. sollten dort geklärt werden, in diesen Fall wohl Wikipedia:Redaktion Recht. Falls nötig kann man später einen Hinweis hier posten bzw. in die RL hier einbinden.-Kmhkmh (Diskussion) 23:23, 1. Jul. 2019 (CEST)
- Hab dort mal hierauf hingewiesen. --Universalamateur (Diskussion) 09:11, 19. Jul. 2019 (CEST)
- Das zitierte Werk heißt nicht „§ 98 …“, sondern dieser Paragraf ist eine Fundstelle in dem Werk und müsste über den Parameter
Fundstelleangegeben werden: - Geschäftsordnung für den Reichstag. In: Büro des Reichstags (Hrsg.): Reichstags-Handbuch VIII. Wahlperiode. Druck und Verlag der Reichsdruckerei, Berlin 1933, S. 32, § 98 (Volltext bei der Bayerischen Staatsbibliothek [abgerufen am 1. Juli 2019]).
- Anders geht es mit dieser Vorlage meines Wissens nicht. Evtl. gibt es eine passendere? --Gamba (Diskussion) 17:44, 16. Jul. 2019 (CEST)
- Klar ist das nicht der Titel. Aber es ist eine Bezeichnung, die wie ein Titel verwendet wird. Fundstelle zu nehmen wäre zwar semantisch richtig, aber ungewohnt.
- Was geht, ist {{Literatur|Titel=<span style="font-style: normal;">Titel=Geschäftsordnung für den Reichstag</span>|...}}: Geschäftsordnung für den Reichstag. In: Reichstags-Handbuch VIII. Wahlperiode.. Aber richtig ist das auch nicht. --Universalamateur (Diskussion) 09:11, 19. Jul. 2019 (CEST)
Die semantisch richtige Auszeichnung wäre die Vorlage:§§, die man auch für beliebige Rechtsquellen verwenden kann. Rechtsquellen sind keine Literatur. Deshalb ginge auch der Parameter Fundstelle in diesem Fall fehl, so zitiert man das nicht. Viel wichtiger als die Vorlage wäre hier, dass ein Permalink auf die digitale Sammlung gesetzt wird, das ist hier urn:nbn:de:bvb:12-bsb00000008-8. Ich habe heute keine Zeit zum Testen, schaut bitte mal, wie das geht, damit man auf die richtige Seite kommt. Die URL oben linkt nur auf die Suchfunktion.--Aschmidt (Diskussion) 10:08, 19. Jul. 2019 (CEST)
+1. Rechtsquellen sind keine Literatur. Sie werden - wo das geht - mit der von Aschmidt angesprochenen Vorlage direkt verlinkt. Auf die Angabe von Fundstellen wie BGBl., GVBl. oder - hier - RGBl. wird verzichtet. --Opihuck 13:11, 19. Jul. 2019 (CEST)
Literatur -> Quellen
@Global Fish: "Artikel sollen nur überprüfbare Informationen aus zuverlässiger Literatur enthalten." sollte in "Artikel sollen nur überprüfbare Informationen aus zuverlässigen Quellen enthalten." geändert werden. Es ist schon lange Usus, dass neben schriftlichen Quellen auch Video- und Audioquellen genutzt werden.--![]() JTCEPB (Diskussion) 10:37, 14. Jul. 2019 (CEST)
JTCEPB (Diskussion) 10:37, 14. Jul. 2019 (CEST)
- Literatur umfast eben nicht nur Printquellen. Dagegen umfasst "Quellen" noch etliches mehr, was in dem Sinne nicht gemeint ist, auch wenn sie zuverlässig sind. "Personal Communication" kann z.B. eine durchaus zuverlässige Quelle sein und in der Wissenschaft zulässig, aber hier eben gerade nicht.
Mit mir hast Du keinen Konsens für diese Änderung. Wenn ich der einzige bin, der das so sieht, soll es nicht an mir liegen, aber bitte erst die Zustimmung dritter und vierter einholen. --Global Fish (Diskussion) 10:48, 14. Jul. 2019 (CEST)- Personal Communication und ähnliches wird ja bei der näheren Erläuterung ausgeschlossen.--
 JTCEPB (Diskussion) 10:56, 14. Jul. 2019 (CEST)
JTCEPB (Diskussion) 10:56, 14. Jul. 2019 (CEST)
- In den Grundsätzen sollte klar stehen, was gemeint ist. Eher sollten spätere Erläuterungen die Regeln in den Grundsätzen unter bestimmten Umständen erweitern können, als nachträglich einschränken.
Abgesehen davon ist Deine Formulierung viel zu nahe am landläufigen „ich habe aus zuverlässiger Quelle gehört, dass..“, was hier natürlich nicht gemeint ist.--Global Fish (Diskussion) 11:15, 14. Jul. 2019 (CEST)
- In den Grundsätzen sollte klar stehen, was gemeint ist. Eher sollten spätere Erläuterungen die Regeln in den Grundsätzen unter bestimmten Umständen erweitern können, als nachträglich einschränken.
- Personal Communication und ähnliches wird ja bei der näheren Erläuterung ausgeschlossen.--
Literatur ist zwar in der Tat im Einzelfall zu einschränkend, allerdings gibt es trotzdem Gründe es gegenüber dem Wort Quellen zu bevorzugen. Zunächst einmal kommt dem Begriff Quellen in historischen Artikeln eine andere Bedeutung zu, was zu Problemen bzw. Missverständnissen führen kann. Und dann gibt es in WP in klare Präferenz für Belege die in Textform vorliegen (gegenüber Video- und Audio-Material bzw. multimedialen Belegen) und möglichst einen editoriellen Prozess und einen Reviewprozess durchlaufen haben.--Kmhkmh (Diskussion) 13:44, 14. Jul. 2019 (CEST)
- In der englischen Wissenschaftssprache, der letztlich unser Vokabular hier durch Übersetzung aus enwiki entstammt, wären es im Artikel die "References". Wenn darauf irgendwie Bezug genommen wird, handelt es sich aber um "the literature". Die references sind unsere dt. "Einzelnachweise" geworden. In dt. Fachbüchern wären es die "Quellenangaben", da steht normalerweise entweder "Literatur" oder "Literaturverzeichnis", gelegentlich "Bibliographie", auch "Quellenverzeichnis" findet sich vereinzelt. Das Problem mit den Geschichtswissenschaften ist ernst zu nehmen, es hat uns schon die leidige "Sekundärliteratur" eingebrockt. Ich sehe kein Problem darin, hier den Ausdruck Literatur auszuwählen, ggf. könnte es auch mal "Literatur und Quellen" heißen. Wir haben hier die etwas merkwürdige, historisch gewachsene Hausregelung, dass es, wenn es einen Abschnitt "Literatur" neben den "Einzelnachweisen" gibt, es als zulässig erachtet wird, dort auch grundlegende Werke aufzulisten, die weder eingesehen noch in die Erstellung des Artikels eingeflossen sind. Deshalb mag es im Einzelfall angeraten sein, den Quellencharakter zu betonen, wenn aus irgendwelchen Gründen nicht mit refs gearbeitet werden soll (z.B., wenn der Text fast vollständig auf einem einzelnen Werk beruht). Dass eine Audio- oder Videodatei tatsächlich als Quelle verwendet wird, wird doch hoffentlich immer eine exotische Ausnahme bleiben. Dafür brauchen wir keine Umbenennung.--Meloe (Diskussion) 16:03, 14. Jul. 2019 (CEST)
- Der Abschnitt Literarur dient halt im Normalfall primär als Lese- bzw. Literarurempfehlung (und nicht als Beleg -oder Werkeverzeichnis), diese kann eben unabhängig von der Erstellung des Artikels erfolgen, insbesondere bei einem (oft auch zeitversetzten) kollaborativen Prozess. Auf en.wp gibt das übrigens auch, da heißt der Abschnitt dann "further reading".--Kmhkmh (Diskussion) 16:26, 14. Jul. 2019 (CEST)
Wir haben hier ein Generationsproblem und gehören zu den ersten, die die Folgen des technologischen Wandels ausbaden müssen.
- Klassischerweise würde man bei „Literatur“ tatsächlich auf Papier gedruckte Werke assoziieren.
- Die Vorstellungswelt entstammt dem letzten Jahrhundert.
- Schon eine Sammlung von Mikrofiche war bereits vor 50 Jahren möglich gewesen, hatte nie eine Druckerpresse gesehen oder Papier rascheln gehört, wäre aber einem gedruckten Werk und mindestens einer Manuskript-Vervielfältigung ebenbürtig gewesen.
- Einigermaßen haltbare Datenträger (etwa CD/DVD), die wie auch Papier eine persistente und mit universell dauerhaft zu pflegender Software (HTML, PDF, plain text, TIFF) eine Sammlung unveränderter Dokumente enthielte, gab es schon Ende letzten Jahrhunderts und wären einem gedruckten Werk gleichzustellen; könnte auch jederzeit auf Papier ausge„druckt“ werden.
- Eine zuverlässig über Jahrzehnte erreichbare Internet-Plattform, die als Dokumentenserver die gleichfalls mit dauerhaft pflegbarer Software lesbaren Ressourcen bereitstellt und sich dafür verbürgt, diese ohne Manipulationen auszuliefern, wäre im aktuellen Jahrhundert auch so eine Art von „Literatur“, aber noch hat sich dafür keine klare Begrifflichkeit herausgebildet (zu denken wäre an die eDiss-Dienste der Unis).
- Eine statische, nicht manipulierte Ressource auf einer langfristig erreichbaren Infrastruktur wäre eine Form der Literatur, für die wir aber noch kein so richtiges Vokabular haben.
- Rein technisch ist das auch so eine Art Internet-Veröffentlichung, aber nicht vergleichbar mit einem Blog, einem Newsticker, einer Datenbank-Abfrage oder sonst einer dynamischen Website.
- Unsere Beleg-Philosophie ist noch sehr mangelhaft auf dieses Jahrtausend und die zukünftigen Herausforderungen zugeschnitten.
VG --PerfektesChaos 18:53, 14. Jul. 2019 (CEST)
- In Internet gibt es den Kurzabschnitt Digitale Schriftlichkeit, auf den auch z.B. von Literatur verlinkt wird. Ich weiß nicht, ob das eine unbemerkte Begriffsetablierung ist, so sehr scheint er noch nicht etabliert zu sein. -- Jesi (Diskussion) 19:27, 14. Jul. 2019 (CEST)
- Ack, schön aufgedrösselt, wobei ich denke, dass man hier nicht so sehr mit Begriffen wie "Literatur" oder "Quelle" alleine zu tun hat (ich persönlich, den Hitorikern zum Trotz, bevorzuge "Quelle", dh Quelle, aus der die von mir gegebene Info stammt; Literatur ist eher "weiterführen", zu empfehlen). Wichtiger ist jedoch ebenfalls, den Begriff "zuverlässig" zu definieren. In zahllosen Texten in dewiki gibt es viel Schrott, ob als Literatur oder Quelle, und die Art, wie man diese in Belegen = Einzelnachweisen anführt, ist teils kriminell (pauschale Links zu einer Hauptseite, wobei es da Tausen Unterseiten gibt, und nur eine von ihnen enthält das, was ich zitierte. -jkb- 19:39, 14. Jul. 2019 (CEST)
- Sorry, aber ich sehe keinen Generationenkonflikt (abgesehen davon, weiß ich von den wenigstens Diskutanten hier, wie alt sie sind). Ich sehe auch nicht, was dramatisch anders geworden wäre. Digital publizierte wissenschaftlichen Journalen oder digital publizierten Büchern spricht doch niemand die Tauglichkeit hier noch den Status als "Literatur" ab. Und der Eingangssatz von Literatur "Literatur ist seit dem 19. Jahrhundert der Bereich aller mündlich (etwa durch Versformen und Rhythmus) oder schriftlich fixierten sprachlichen Zeugnisse." widerspricht dem doch auch nicht. --Global Fish (Diskussion) 20:43, 14. Jul. 2019 (CEST)
Per Global Fish würd ich diese Büchse lieber geschlossen lassen.--the artist formerly known as 141.84.69.20 21:30, 14. Jul. 2019 (CEST)
- Wir müssten die umseitige Richtlinie für die Autorenschaft schon so gestalten, dass alle unsere Mitarbeiter die Begrifflichkeit noch verstehen und sie trennscharf sachgerecht anwenden können.
- Nimmt man das Zitat von Global Fish „aller mündlich (etwa durch Versformen und Rhythmus) oder schriftlich fixierten sprachlichen Zeugnisse“ zum Maßstab, dann können wir die Trennung zwischen den Abschnitten „Literatur“ und „Weblinks“ aufheben und gemeinschaftlich alles unter „Literatur“ auflisten. Auch alle Twitter-Nachrichten des ehrlichsten Präsidenten ever zählen dann zur Literatur, Rhythmus ist immer, und weil auch die mündlich fixierten Zeugnisse eingeschlossen sind, zählen nunmehr auch alle Hörbücher, Schallplattenaufnahmen von Reden und sämtliche Dokumentarfilme mit sprachlichen Passagen auch zur „Literatur“, wenigstens wenn der Dokumentarist in Reimen unterlegt.
- Jede dynamische Website, etwa der heutige Wetterbericht in Dingenskirchen, ist genauso viel und genauso wenig „Literatur“ wie auch eine nur online publizierte wissenschaftliche Zeitschrift.
- Ich wüsste seit einem Dutzend Jahre hier tätige Fachautoren mit fünfstelligem ANR-Count, die würden sich eher die Hände abhacken lassen als eine digitale wissenschaftliche Zeitschrift als ernstzunehmende Literatur zu akzeptieren.
- Mir sind auch schon mehrere prominente Autoren untergekommen, die verschieben den wöchentlich erscheinenden gedruckten Spiegel aus dem Abschnitt „Literatur“ in den Abschnitt „Weblinks“, weil dieser nicht wissenschaftlich genug wäre und außerdem ist das nur ein Online-Blog, bei dem auf jeder Webseite obendrüber groß „Spiegel Online“ drübersteht. Diskussion absolut zwecklos.
- WP:LIT geht implizit von auf Papier gedrucktem Material aus; WP:WEB ist alles, was nicht auf Papier gedruckt ist. Unsere Begrifflichkeit müsste nachgeschärft und kommuniziert werden. WP:LIT#Online-Literatur meint dem Sinn nach die digitalen Reproduktionen auf Papier gedruckter Werke. Nirgendwo auf der Seite steht eine Definition, was für originäre Medien die Zugehörigkeit zu „Literatur“ begründen würden und wie sich andere Publikationsformen davon abgrenzen würden, welche dann also in den Abschnitt „Literatur“ und welche zu den „Weblinks“ gehören würden.
- Was die diesen Abschnitt eröffnende Diskrepanz „Literatur“ ./. „Quelle“ angeht, könnte ich die Vokabel „Nachweise“ anbieten. Da wüsste ich keinen Unterschied zum Seitennamen „Belege“, und es hält alle Interpretationen hinsichtlich des Mediums offen.
- VG --PerfektesChaos 21:42, 14. Jul. 2019 (CEST)
- dann können wir die Trennung zwischen den Abschnitten „Literatur“ und „Weblinks“ aufheben und gemeinschaftlich alles unter „Literatur“ auflisten - sorry, aber Anlass dieses Threads war nicht das, was für Abschnittsüberschriften am Ende eines Artikels stehen (diese Frage gehört übrigens nur begrenzt hierher), sondern der Anlass war der erste Satz von Wikipedia:Belege#Grundsätze. Dass ein und dasselbe Wort (hier "Literatur") in verschiedenen Kontexten unterschiedliche Bedeutung haben kann, ist eine Binsenweisheit.
Übrigens gibt es einen grundlegenden logischen Unterschied zwischen außerhalb der Wikipedia vorhandenen Dingen (Quellen, Publikationen, Internetseiten) und Referenzen in der Wikipedia auf diese (Nachweise, Quellen*angaben*). Das Wort "Beleg" kann sich auf beides beziehen, ändert nichts daran, dass beides verschiedene Dinge sind. --Global Fish (Diskussion) 21:47, 14. Jul. 2019 (CEST)
- dann können wir die Trennung zwischen den Abschnitten „Literatur“ und „Weblinks“ aufheben und gemeinschaftlich alles unter „Literatur“ auflisten - sorry, aber Anlass dieses Threads war nicht das, was für Abschnittsüberschriften am Ende eines Artikels stehen (diese Frage gehört übrigens nur begrenzt hierher), sondern der Anlass war der erste Satz von Wikipedia:Belege#Grundsätze. Dass ein und dasselbe Wort (hier "Literatur") in verschiedenen Kontexten unterschiedliche Bedeutung haben kann, ist eine Binsenweisheit.
- "Weblinks" wird für Weiterführendes benutzt, steht auch so in WP:WEB, eine Vermengung mit Literatur wäre also grob fahrlässig. Literatur ist erstmal insbesondere Sekundärlit, redaktionell und unabhängig verfasst.--the artist formerly known as 141.84.69.20 21:52, 14. Jul. 2019 (CEST)
@PerfektesChaos: Nein, mMn. geht WP:LIT keineswegs implizit von bedrucktem Papier aus, wenn überhaupt dann umfasst Literatur das, was früher traditionell auf Papier gedruckt wurde. Wobei "früher" sich auf eine Zeit irgendwann für der Entstehung der WP bezieht (so Ende des 20. Jahrhunderts. Das schließt aber "native" digitale Publikation ein, die nie gedruckt und dementsprechebd nie nachträglich digitalisiert wurden. Also insbesondere auch Zeitschriften, Magazine, Zeitung oder Bücher die primär oder ausschließlich digital und/oder online vertrieben werden. Das entspricht im übrigen auch dem Literaturbegriff außerhalb der WP, der ja auch schon lange digitale Publikations bzw. Formate umfasst. Der gemeinsame Aspekt, der es zu Literatur macht, ist das die Inhalte als Text produziert werden (was früher auch immer Gedrucktes bedeutete) und (inbesondere aus WP-Sicht) möglichst noch editoriellen Prozess und eine Review durchlaufen haben sollten und eine gewisse Reputation besitzen (durch Autor, Verleger, Reviews).
WP:WEB umfasst dementsprechend auch nicht einfach alles was online vorliegt, sondern eigentlich nur alles was online vorliegt und nicht unter (digitale) Literatur fällt. Also Fachzeitschriften und Fachbücher, die online vorliegen, gehören in den Abschnitt Literatur und nicht in Weblinks.--Kmhkmh (Diskussion) 23:15, 14. Jul. 2019 (CEST)
- +1. Bitte nicht alles nur unter formalistischen, sondern unter (je nach Fachrichtung) methodisch korrekten Gesichtspunkten betrachten. Ich erinnere mich zudem gerne an ellenlange Diskus, dass man damals in Personenartikeln die "Genealogie Mittelalter" verlinken müsse, besser noch der gedruckten Lit vorziehen solle - weil die doch so schön einfach abrufbar sei. Jahre später war die offline und wer hat dann die Belege aus der Fachlit eingefügt? Nobody. Nein, danke. --Benowar (Diskussion) 23:46, 14. Jul. 2019 (CEST)
Da "Quellen" scheinbar die Gemüt in Wallung bringen, mach ich gerne Vorschläge für Alternativworte: Werke oder Publikationen. Beide umfassen im Gegensatz zum Wörtchen Literatur auch audiovisuelle Medien. Ich persönlich würde Werke bevorzugen, da Pub. auch noch sehr mit dem Printwesen verbunden ist.--![]() JTCEPB (Diskussion) 09:25, 15. Jul. 2019 (CEST)
JTCEPB (Diskussion) 09:25, 15. Jul. 2019 (CEST)
- Statt Literatur könnte man „zuverlässigen, dauerhaften Medien“ formulieren, allerdings bin ich für einen Vorrang von Gedrucktem über allem anderen. -- 217.70.160.66 09:35, 15. Jul. 2019 (CEST)
- Man könnte vieles formulieren. Allerdings hat der Artikelautor dabei selbst die Freiheit. Der jetzige Text ist nur insofern missverständlich, als dass eben die Angabe von "Belegen" die nicht gleichzeitig "Einzelnachweise" sind, de facto nicht vorgesehen ist. Es wurde oben richtig angemerkt, dass Angaben im Abschnitt weblinks keine Belege sind (zumindest ich selbst gebe da nur weiterführende links an und führe tatsächlich als Beleg verwendete weblinks normalerweise als Einzelnachweise auf, wenn nötig doppelt). Dies gilt allerding für den Abschnitt "Literatur" genauso. Es sollte also vermerkt werden, wenn unter "Literatur" auch Quellen aufgeführt werden sollen.--Meloe (Diskussion) 09:51, 15. Jul. 2019 (CEST)
- Ich wiederhole mich ungern, aber muss es hier wohl tun. Dringende Bitte: bitte nicht die Diskussion zerfasern! Es geht in dieser Diskussion *nicht* darum, wie die Abschnitte "Literatur";"Weblinks";"Einzelnachweise" genannt werden sollen (und dazu wäre diese Seite auch nur sehr am Rande der richtige Ort). Es geht in dieser Diskussion um einen Änderungsvorschlag für den ersten Satz von Wikipedia:Belege#Grundsätze. Wenn wir hier über alles mögliche reden, werden wir weder dem Anliegen derer gerecht, die den Satz ändern möchten noch derer, die die jetzige Formulierung besser finden. Danke. --Global Fish (Diskussion) 10:01, 15. Jul. 2019 (CEST)
- Man könnte vieles formulieren. Allerdings hat der Artikelautor dabei selbst die Freiheit. Der jetzige Text ist nur insofern missverständlich, als dass eben die Angabe von "Belegen" die nicht gleichzeitig "Einzelnachweise" sind, de facto nicht vorgesehen ist. Es wurde oben richtig angemerkt, dass Angaben im Abschnitt weblinks keine Belege sind (zumindest ich selbst gebe da nur weiterführende links an und führe tatsächlich als Beleg verwendete weblinks normalerweise als Einzelnachweise auf, wenn nötig doppelt). Dies gilt allerding für den Abschnitt "Literatur" genauso. Es sollte also vermerkt werden, wenn unter "Literatur" auch Quellen aufgeführt werden sollen.--Meloe (Diskussion) 09:51, 15. Jul. 2019 (CEST)
- Spricht denn etwas dagegen, statt Literatur (was auch aus meiner Sicht tatsächlich zu eng gefasst ist) die Bezeichnung der Regelseite selbst zu verwenden und also Artikel sollen nur überprüfbare Informationen aus zuverlässigen Belegen enthalten zu schreiben? – Andererseits fände ich hier statt Belegen auch zuverlässigen Informationsquellen einen gangbaren Weg: Denn der hier diskutierte Satz wird mE direkt wieder aufgenommen unter der Überschrift Was sind zuverlässige Informationsquellen? etwas weiter drunter, ein Gleichklang da würde auch die innere Kohärenz der Regelseite stärken. --Andropov (Diskussion) 10:10, 15. Jul. 2019 (CEST)
- Im gleichen Zuge könnte man die Überschrift unten "Wikipedia ist keine Quelle" auch in Wikipedia ist keine zuverlässige Informationsquelle umwandeln, damit klarer ist, dass sich alles das aufeinander bezieht. --Andropov (Diskussion) 10:21, 15. Jul. 2019 (CEST)
- Naja, Beleg passt m.E. hier schon rein logisch nicht. Ein Beleg ist entweder ein Verweis auf eine Quelle oder eine Aussage aus einer Quelle, aber nicht die Quelle selbst. Solche Zusammensetzungen wie Informationsquellen finde ich wiederum sprachlich unschön. Und "Wikipedia ist keine zuverlässige Informationsquelle"? Ja sollte man sich lieber gar nicht erst aus Wikipedia informieren? Das meinen wir wohl auch nicht wirklich. Natürlich ist Wikipedia eine Informationsquelle, nur keine Grundlage für Artikel.
Diskutabel fände ich die Vorschläge von JTCEPB oben mit den "Werken" oder "Publikationen". "Werk" wäre mir dabei zu allgemein. Und so ganz verstehe ich das Problem nicht. Welche audiovisuellen Quellen wären denn per se geeignete Referenzen? Audiovisuelle Quellen wären entweder Lehrmaterialien (da gäbe es aber bessere Quellen) oder journalistische Werke (taugen unter Umständen, aber nicht per se) oder privat (taugen in der Regel gar nicht). --Global Fish (Diskussion) 10:29, 15. Jul. 2019 (CEST)- Prinzipiell "verlässliche" Nachrichten und Dokumentationen, die insbesondere bei aktuellen Theme eine gewisse Rolle spielen. Die Aussage, das "Lehrmaterialien" eher nicht geeignet sind ist in dieser allgemeinheit eher unsinning, Lehrbücher sind eine Standardquelle für Referenzen in zahlreichen WP_Artikeln. Auch der Hinweis, dass es doch in solchen Fällen doch geignetere btw. bessere Referenzen gäbe trifft es nicht so ganz, solche gibt es eigentlich immer. Die entscheidende Frage ist, ob Rferenzen ausreichend, d.h. bestimmte Mindestanforderungen erfüllen, so dass sie zum Beleg von WP_Inhalten herangezogen werden können--Kmhkmh (Diskussion) 11:39, 15. Jul. 2019 (CEST)
- Da habe ich mich unklar ausgedruckt. Was ich meinte, ist, dass Lehrbücher in der Regel für unsere Zwecke besser (und sei es schlichtweg im Sinne von "für uns praktischer handhabbar") sind sind als audiovisuelles Lehrmaterial. Ich finde audiovisuelles Lehrmaterial nicht ungeeignet, aber auch nicht für so wesentlich, als dass man deswegen die Formulierungen hier ändern müsste.--Global Fish (Diskussion) 12:07, 15. Jul. 2019 (CEST)
- Prinzipiell "verlässliche" Nachrichten und Dokumentationen, die insbesondere bei aktuellen Theme eine gewisse Rolle spielen. Die Aussage, das "Lehrmaterialien" eher nicht geeignet sind ist in dieser allgemeinheit eher unsinning, Lehrbücher sind eine Standardquelle für Referenzen in zahlreichen WP_Artikeln. Auch der Hinweis, dass es doch in solchen Fällen doch geignetere btw. bessere Referenzen gäbe trifft es nicht so ganz, solche gibt es eigentlich immer. Die entscheidende Frage ist, ob Rferenzen ausreichend, d.h. bestimmte Mindestanforderungen erfüllen, so dass sie zum Beleg von WP_Inhalten herangezogen werden können--Kmhkmh (Diskussion) 11:39, 15. Jul. 2019 (CEST)
- Naja, Beleg passt m.E. hier schon rein logisch nicht. Ein Beleg ist entweder ein Verweis auf eine Quelle oder eine Aussage aus einer Quelle, aber nicht die Quelle selbst. Solche Zusammensetzungen wie Informationsquellen finde ich wiederum sprachlich unschön. Und "Wikipedia ist keine zuverlässige Informationsquelle"? Ja sollte man sich lieber gar nicht erst aus Wikipedia informieren? Das meinen wir wohl auch nicht wirklich. Natürlich ist Wikipedia eine Informationsquelle, nur keine Grundlage für Artikel.
- Angemessen erscheint mir "Veröffentlichungen". Denn damit werden Archivbelege und Hörensagen ausgeschlossen und keine Aussage über das verwendete Medium gemacht. Grüße --h-stt !? 18:20, 18. Jul. 2019 (CEST)
- +1. --Jossi (Diskussion) 20:59, 18. Jul. 2019 (CEST)
- +1. Zweifellos die angemessene Lösung. Steht ja so schon ganz oben in der Einleitung: Wikipedia-Artikel sollen sich nur auf zuverlässige Publikationen stützen, somit eigentlich redundant, aber wegen des zusammenfassenden Charakters der Einleitungssätze vertretbare Wiederholung. Nwabueze 01:55, 19. Jul. 2019 (CEST)
- +1--Kmhkmh (Diskussion) 02:31, 19. Jul. 2019 (CEST)
- Ich halte es auch für akzeptabel. --Global Fish (Diskussion) 07:30, 19. Jul. 2019 (CEST)
- +1. --Meloe (Diskussion) 10:19, 19. Jul. 2019 (CEST)
- Das ist eindeutig, danke schön. Ich habe es gerade umgesetzt. Schön, wenn etwas so einfach geht, so macht Wikipedia Spaß. Grüße --h-stt !? 21:37, 19. Jul. 2019 (CEST)
Abschnitte Literatur, Weblinks, Einzelnachweise
@Kmhkmh et al.:
- Dann müsste diese Betrachtungsweise explizit auf WP:LIT definiert werden, und dazu vorher überhaupt erstmal ein Konsens erarbeitet werden.
- Ich bin seit 2004/05 als Leser und IP-Bearbeiter dabei und hatte das Säuglingsalter der WP fasziniert verfolgt. Die Projektseiten sind wesentlich in dieser Zeit verfasst worden und wurden im Kern bis heute nicht fortentwickelt. Die WP-Pioniere gingen kurz nach der Jahrtausendwende als selbstverständlich davon aus, dass
- Literatur ist, was auf Papier gedruckt in mindestens einer öffentlich zugänglichen Bibliothek im Regal steht;
- alles andere in diesem komischen Neuland ist Weblink.
- WP:WEB #Abgrenzung zu anderen Typen von Belegen stellt diese manichäische Zweiteilung der Welt nochmal explizit klar, kennt aber immerhin schon „Elektronische Zeitschrift“. In WP:LIT sind die aber noch nicht nachlesbar angekommen.
- Die überkommene schlichte Einteilung funktioniert bis heute für die einfachen Fälle, lässt aber alle anderen Medien und komplizierten Situationen außen vor und die Autoren ohne Anleitung und im Streit für jeden einzelnen Artikel bei
- eBook, kein offener Internetabruf, kein Papier
- Veröffentlichung auf CD/DVD
- Film, Dokumentarfilm, Beitrag in einem Politikmagazin, Nachrichtensendung
- Digitale Fachzeitschriften, elektronische Dissertationen
- Audio-Veröffentlichungen aller Art
- Gesetze, internationale Verträge, Normen und Standards
- Bildbeweis (Foto vom Grabstein).
- WP:ZR nennt unter #Formatierungsregeln für Literatur ausschließlich auf Papier basierende Publikationen und unterstellt zumindest implizit immer Papier; ansonsten geht diese Formatierung nicht sauber auf. Dann gibt es „weitere Dokumentarten“, und kennt dort Patente sowie „Internetquellen und Weblinks“. Eine digitale Fachzeitschrift wäre nach der dortigen Aufteilung als „Internetquelle“ in Abgrenzung zu „Literatur“ anzusehen; ansonsten fehlte die trennscharfe Unterscheidung zwischen einer digitalen Fachzeitschrift einerseits versus Spiegel Online oder einer frei kombinierten Datenbankabfrage mit individuellem Resultat oder der Homepage einer Rockband.
- Wir haben eine Reihe sehr lautstarker Premium-Hauptautoren, die fordern, dass die Welt der Wikipedia gefälligst genauso zu sein habe wie damals, als sie ihre Magisterarbeit in die mechanische Schreibmaschine gehackt hatten.
- Der gesamte Komplex LIT-WEB-BLG-ZR-EN gehört nach einem Jahrzehnt des Stillstands behutsam modernisiert, aktualisiert, präzisiert, auf nicht-triviale Fälle erweitert und ergänzt; außerdem in Teilen restrukturiert und verständlicher und eindeutig gemacht; Redundanzen und Inkonsistenzen sind zu beseitigen. Wir sind heute zwei Millionen Artikel weiter als die Entstehungszeit der Projektseiten, und mittlerweile sammelten wir viele Erfahrungen und trafen öfter auf komplexe und moderne Publikationsformen.
- Nichts von den in diesem Abschnitt geäußerten Ansichten ist konkret und präzise ohne andernfalls völlig offenen Interpretationsspielraum auf unseren Projektseiten nachlesbar und mit exakten Definitionen und Unterscheidungskriterien versehen.
- Die Überschrift und der Anlass dieses Abschnitts, die geäußerten Interpretationen und die alltägliche Erfahrung mit dem Verständnis seitens gestandener Autoren zeigt, dass der Ausdruck „Literatur“ mitnichten klar ist. Als Wissenschaftler habe ich mal gelernt, dass man mit sauber definierten Begriffen arbeiten solle. Daran mangelt es offensichtlich, und damit ist die konsistente Interpretation in allen beteiligten Projektseiten und Richtlinien nicht mehr möglich, und auch nicht die konsistente und für Leser nachvollziehbare Auswirkung auf die Gliederung der Artikel in Abschnitte.
VG --PerfektesChaos 16:00, 15. Jul. 2019 (CEST)
- Ich hab Dir mal ne Abschnittsüberschrift spendiert. Sind ja alles berechtigte Fragen, aber diese Fragestellung hat *nichts* mit dem Anliegen des obigen Threads zu tun (außer dass da das Buzzword "Literatur" auftauchte); da ging es um eine Formulierungsänderung im oberen Teil der Vorderseite. --Global Fish (Diskussion) 16:22, 15. Jul. 2019 (CEST)
- PS: zur Sache: zeigt, dass der Ausdruck „Literatur“ mitnichten klar ist - ja. Viele Begriffe, mit denen wir hier zu tun haben (Literatur, Belege, Quellen, Werke, Referenzen ... und etliche andere) sind leider mehrdeutig, bedeuten in verschiedenen Kontexten verschiedenen Sachen. Das stört in der Tat, kann ich nachvollziehen, aber ich weiß keine Lösung.
Und im Grundsatz verstehe ich Dich auch: da hat irgendwer vor >10 Jahren irgendwas hingeschrieben, und das ist nun in Stein gemeißelt. Nicht änderbar, weil sich alle gegenseitig blockieren. --Global Fish (Diskussion) 16:27, 15. Jul. 2019 (CEST)- PPS: mal aus der Perspektive von WP:Belege wenngleich aus meiner subjektiven Sicht zu Deinen Punkten, etwas umsortiert:
- eBook, kein offener Internetabruf, kein Papier - neue Medien, würde ich analog zu klassischen Büchern behandeln
- Digitale Fachzeitschriften, elektronische Dissertationen - dito, analog zu Zeitschriften/Dissertation auf Papier
- Veröffentlichung auf CD/DVD - so nicht beurteilbar. Sagt genauso wenig aus, wie "Veröffentlichung auf Papier". Das Trägermedium allein sagt nichts über die Tauglichkeit als Quelle aus.
- Audio-Veröffentlichungen aller Art - dito.
- Film, Dokumentarfilm, Beitrag in einem Politikmagazin, Nachrichtensendung - journalistische Quellen. Als Quelle für uns eingeschränkt tauglich; eher schlechter handbar als Druckmedien (a) wegen höherem Aufwand zur Überprüfung und b) weil tendenziell exakte Formulierungen dort weniger wichtig sind. Filme, Magazine etc. gibts aber auch schon zig Jahre, das ist nichts wirklich Neues.
- Gesetze, internationale Verträge, Normen und Standards - keine neue Frage. Gabs schon immer. Das ist der klassische Diskussionspunkt über Nutzung von Primärquellen.
- Bildbeweis (Foto vom Grabstein). - auch keine neuen Fragen. Klassischer Diskussionspunkt über Nutzung von OR bei Trivialfällen.
- Fazit: ich sehe nichts, was wirklich ein grundlegend neues Problem wäre. eBooks, Digitale Fachzeitschriften lassen sich m.E. völlig äquivalent zu Printmedien behandeln. Der Rest sind m.E. nur altbekannte und immer wieder diskutierte Fragen. --Global Fish (Diskussion) 16:44, 15. Jul. 2019 (CEST)
- PPS: mal aus der Perspektive von WP:Belege wenngleich aus meiner subjektiven Sicht zu Deinen Punkten, etwas umsortiert:
- Also ich bin seit 2007 dabei und habe auch diverse Diskussionen dazu verfolgt und a war klar, dass Literatur immer auch digital publizierte Literatur umfasst, das gilt insbesondere für Fachzeitschriften und Fachbücher, die eben auch schon seit den Frühzeiten der Wikipedia existieren. Unklarer war/ist hingegen die Einordnung von Zeitungen und allgemeeinen Zeitschriften, die landen manchmal unter Literatur (wenn eine Printausgabe existiert) und sonst meistens unter Weblinks. Zudem hängen die Inhalte beider Abschnitte auch stark von Artikelthema ab. Idealerweise stehen im Abschnitt Literatur die Standardliteratur und Lese-Empfehlungen zum Artikelthema, das heißt eigentlich (fast) nur Fachbücher, Fachzeitschriften und eventuell poplärwissenschaftliche oder journalistische Bücher und zwar egal ob sie nun gedruckt oder digital erscheinen. Wenn solche Literatur aber für diverse Artikel nicht zur Verfügung stehen, dann sammeln sich im Abschnitt Literatur vermutlich (gedruckte Zeitungsartikel und Ähnliches, die aber auch oft unter Weblinks gepackt werden,wenn sie (auch) online vorliegen.
- Ansonsten ist es so wie Globalfish es oben sagt, leider ist keine der Begriffsvarianten wirklich eindeutig und besitzt eine wirklich (im Detail) einheitliche Verwendung über alle Themengebiete der WP.--Kmhkmh (Diskussion) 16:52, 15. Jul. 2019 (CEST)
zu viel, zu komplex
Dieser Artikel "erschlägt" mich und überfordert mein Zeitkontingent. Er geht viel zu sehr in die Tiefe. Ich will kein Experte werden. Logofilus (Diskussion) 21:01, 14. Jul. 2019 (CEST)
- Nur die Einleitung lesen und Rest nur bei Bedarf/Unklarheiten.--Kmhkmh (Diskussion) 23:22, 14. Jul. 2019 (CEST)
User generated content oder Wikipedia ist keine Quelle
Ich denke der Abschnitt "Wikipedia ist keine Quelle" sollte etwas allgemeiner verfasst werden. Ich arbeite derzeit gelegentlich Verlinkungen auf geni.com ab. Dabei ist mir heute der User Virtualiter bzw. ein Benutzer mit gleichartigen Verhalten Namens Kyber mit der Sperrbegründung "Fake-Artikel nach eigener Aussage http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Benutzer_Diskussion:Kyber&diff=48496296&oldid=48496237" aufgefallen.
In manchen Fällen lag das Alter des Geni.com Eintrags und das Alter des Artikels im Wikipedia recht nahe beieinander. Mit der Sperrbegründung von Kyber kommt bei mir nun ein ungutes Gefühl hoch. (die schnellgelöschten Artikel von Koenraad kann ich nicht einsehen).
Da der erwähnte Benutzer vorrangig unbelegte, oder nur durch User-Generated-Gontent entstanden Genealogie-Seiten belegt Lemma erstellte oder bestehende Lemma entsprechend erweiterte, mit Quellen die er möglicherweise selbst anlegte, kann ich zum derzeitigen Stand nicht ausschließen dass weitere Fake-Artikel angelegt wurden.
Anmerkungen zu den Genealogie-Seiten: es gibt einige, die nach wissenschaftlichen Kriterien arbeiten und entsprechend Belege anbieten, und es gibt welche die durch Benutzer selbst erstellt werden. Letztere sind komplett untauglich. Ich wäre froh, würde der umseitige Abschnitt deutlicher ausformuliert. Frohes Schaffen — Boshomi ⌨ ![]() 20:57, 22. Aug. 2019 (CEST)
20:57, 22. Aug. 2019 (CEST)
offenerhaushalt.de
Moin, ein Benutzer fügte kürzlich in mehrere Behördenartikel Angaben zum Haushaltsvolumen mit der Website "offenerhaushalt.de" als Beleg ein, z.B. hier. Mal abgesehen von der Frage, ob kamerale und doppische Haushalte ohne weiteres miteinander vergleichbar sind, stellt sich mir v.a. die Frage, ob ein offenes Mitmach-Projekt eine geeignete Quelle ist oder nicht im weiteren Sinne unter unsere Regel "Wikis sind keine Quelle" fällt. Und ob man nicht lieber auf auf die offiziellen Haushaltspläne bzw. die entsprechenden Parlamentsdrucksachen verlinken sollte? Gibt es dazu Meinungen? --Uwe Rohwedder (Diskussion) 13:58, 27. Aug. 2019 (CEST)
- Meines Erachtens keine geeignete Sekundärquelle. --Johannes (Diskussion) (Aktivität) (Schwerpunkte) 15:32, 27. Aug. 2019 (CEST)
Liste in der engl. Wikipedia zur Einschätzung von Belegen durch die Community
Ist diese sehr aufschlussreiche Liste hier bereits bekannt? Wikipedia:Reliable sources/Perennial sources.
Als einziges deutschsprachiges Medium wurde die BILD-Zeitung bewertet. Die Einschätzung gehört zur Gruppe "Generally unreliable" (ganze Gruppen-Erklärung siehe dort). Und als Kommentar zu BILD steht. Bild is a tabloid that has been unfavourably compared to The Sun. A few editors consider the source usable in some cases. --KurtR (Diskussion) 23:25, 30. Aug. 2019 (CEST) Update --KurtR (Diskussion) 23:43, 30. Aug. 2019 (CEST)
- Ich hab diesen Beitrag erst gesehen, nachdem ich die Einfügung auf der Vorderseite wieder entfernt habe. Es ist für uns nur von äußerst untergeordnetem Interesse, wie andere WP so etwas bewerten. Wir haben unsere Regeln. -- Jesi (Diskussion) 13:03, 31. Aug. 2019 (CEST)
- Haben wir die in dem Fall tatsächlich, oder sind wir da nicht eher ein Entwicklungs
landwiki? Eine eigene Seite als Gegenstück zu en:Wikipedia:Reliable sources haben wir schon mal nicht, sondern nur einen Abschnitt in Wikipedia:Belege. Was die Verwendbarkeit von Belegen angeht, läuft es meist auf die Frage hinaus, wer sich gerade mit seinen Behauptungen durchsetzt. Ein Blick auf die differenzierten und ausdiskutierten Bewertungen der englischen Seite kann nicht schaden, da könnten wir uns die eine oder andere Scheibe abschneiden. Man kann zum Beispiel nachlesen, wie wenig die IMDb als Beleg taugt (was ich, gegen Windmühlen kämpfend, immer wieder sage), auf der hier viele Autoren ganze Artikel aufbauen. --Sitacuisses (Diskussion) 13:31, 31. Aug. 2019 (CEST)- +1 Zum einen schadet es nicht insbesondere solange de.wp keine eigene Liste führt. Zum anderen verwenden viele Autoren auf de.wp auch englischsprachige Belege und dies es eben auch manchmal ohne sich über den "Zuverlässigkeitsstatus" diverser englischsprachigen Medien so im Klaren zu sein, wie das vielleicht bei deutschsprachigen Medien wären.--Kmhkmh (Diskussion) 13:57, 31. Aug. 2019 (CEST)
- Ebenfalls +1: Ich habe die Liste gerade zum ersten Mal angesehen und fand sie ausgesprochen aufschlussreich; viele meiner eigenen Erfahrungen mit amerikanischen Medienangeboten habe ich darin bestätigt gefunden. Und die Fans von RT/Sputnik/Epoch Times bekommen da eine fundierte Entgegnung. Halte ich zumindest auch für uns nutzbar, solange wir da nichts Eigenes entwickeln. Der Spiegel steht als deutschsprachiges Medium übrigens auch drin, interessanterweise mit Nennung von Relotius. Gruß, --Andropov (Diskussion) 14:02, 31. Aug. 2019 (CEST)
- Haben wir die in dem Fall tatsächlich, oder sind wir da nicht eher ein Entwicklungs
- Die Sache ist sicherlich interessant auch für uns. Allerdings fangen Benutzer und Benutzerinnen wie ich eine bin, mit derartigen englischsprachigen Listen nichts an, da die dafür notwendigen Englischkenntnisse zu rudimentär sind. Diesbezüglich wäre von Vorteil, wenn es davon als deWP-Gegenstück eine deutschsprachige Version geben würde. Und könnte auch, um auch von Wirkung zu sein, bei Einbindung gelisteter Quellen bei der editierenden Artikelarbeit dann auch als Hinweis eingeblendet werden, meint --Elisabeth 20:51, 31. Aug. 2019 (CEST)
